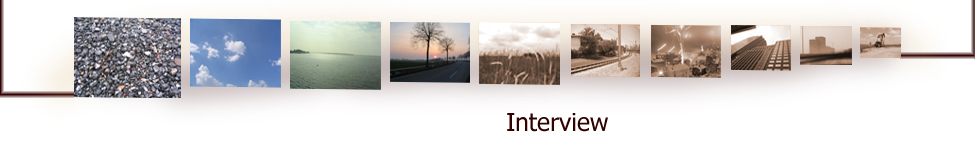Die Hinterhöfe der Sprache
Elf Jahre lang schrieb Axel Hacke für das Magazin der Süddeutschen Zeitung in der Kolumne „Das Beste aus meinem Leben“ über den alltäglichen Wahnsinn einer Kleinfamilie. Weil seine Leser ihm zunehmend falsch verstandene Liedtexte zusandten, erzählte er auch davon. Nach den Liedtexten flatterten weitere schräge Wortschöpfungen auf seinen Schreibtisch und auch er selbst sammelte fleißig, bis er schließlich den „Wortstoffhof“ einrichtete. Als Erklärung schreibt er im Vorwort des gleichnamigen Buches: „Man soll Wörter nicht gering achten. Man soll sie nicht wegwerfen. Man kann sie vielleicht wieder verwenden, und wenn es nur zum Spaß ist. Zum Basteln.“ Im Interview spricht Axel Hacke darüber, warum er als Autor in Bewegung bleiben möchte und warum die Deutschen Angst vor Veränderung haben.
Ihre Kolumne „Das Beste aus meinem Leben“ wurde von „Das Beste aus aller Welt“ abgelöst. Schreiben Sie jetzt über die Hunde im Weißen Haus und den Genfer Teilchenbeschleuniger, weil Sie vom Thema Familienleben gelangweilt waren?
Axel Hacke: Irgendwann war es eben genug. Wenn etwas zur Gewohnheit wird, sollte man es verändern. Ein Autor muss in Bewegung bleiben.
War vielleicht auch der Journalist in Ihnen nicht mehr gefordert? Für „Das Beste aus aller Welt“ recherchieren Sie wieder viel mehr.
Hacke: Ich bin eigentlich gar nicht mehr so sehr Journalist. Ich wollte auch nicht dahin zurück. Ich wollte einfach etwas anderes machen und die Themen nicht nur im unmittelbaren Umfeld suchen. Das Hirn wird dabei durchgelüftet. Andererseits finde ich es gerade fast etwas schade, „Das Beste aus meinem Leben“ aufgegeben zu haben. Diese ganze Weltkrisen-Finanzdrama-Situation könnte man sehr schön an einer Familiengeschichte erzählen.
In „Das Beste aus meinem Leben“ schrieben Sie irgendwann von einem falsch verstandenen Liedtext. Über dieses Phänomen entstand ein reger Austausch mit Ihren Lesern. Was war letztendlich der Auslöser, sich für den „Wortstoffhof“ noch mit anderem schrägen Sprachunkraut zu beschäftigen?
Hacke: Es landeten einfach immer mehr Sprachfundstücke auf meinem Schreibtisch, die nichts mehr mit den Liedtexten zu tun hatten. Das fing dann einfach an, mich zu interessieren. Ich plane da nichts oder sehe ein großes Thema und denke, dass muss ich jetzt machen.
Aber das Thema Ihrer Texte, die deutsche Sprache, interessiert die Menschen anscheinend gerade sehr. Bastian Sick, Autor der Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, füllt mit seinen Lesungen riesige Hallen.
Hacke: Dieses Interesse gab es schon immer. Bevor Bastian Sick diese Sachen geschrieben hat, gab es ja auch schon Autoren wie Wolf Schneider, die sich für die Sprachpflege eingesetzt haben. Heute ist das Angebot einfach größer und die Leute reagieren anders darauf. Sick schreibt eben keine Kolumne im Feuilleton der Zeit, sondern im Internet. Da erreicht man ein ganz anderes Publikum.
Aber Ihnen geht es nicht um die Belehrung?
Hacke: Ich will nicht der nächste Sprachhüter werden. Und ich könnte nie eine belehrende Sprachkolumne schreiben, weil ich dann zu viel Angst hätte, dass einer kommt und mir erklärt, was ich gerade selbst falsch gemacht habe. Ich habe mich noch nie sehr für Grammatik interessiert. Meine Herangehensweise ist poetischer, schriftstellerischer. Die Freude am Wort oder an dem, was gerade nicht richtig ist. Der Spaß am Irrtum.
Ist das Ihre Form der Sprachpflege?
Hacke: Ja, aber eben nicht so, wie die Sprachpfleger sie verstehen. Die haben eine furchtbar spießige, nationalistische Sicht auf die Sprache. Mir geht es eher darum, mit dem Spaß an der Sache auch die Lust der Menschen zu wecken, sich wieder anders mit der Sprache auseinanderzusetzen. Davon haben sie viel mehr, als sich mit Regelgeschichten zu beschäftigen.
Im Vorwort zum „Wortstoffhof“ schreiben Sie: „… und noch im letzten Ich-mach-dich-Messer-Dialog zweier Neuköllner Türkenjungs steckt mehr Kraft des Deutschen als in den Teilnehmern betulicher Sprachhütertagungen.“ Was ist das für eine Kraft?
Hacke: Das ist natürlich provokant formuliert. Aber auch die legendäre Rede von Giovanni Trapattoni ist den Menschen heute noch in Erinnerung geblieben, weil da jemand mit unheimlicher Energie gesprochen hat, obwohl er nicht besonders gut Deutsch konnte. Da kamen vollkommen neue Wörter bei raus, völlig neue Satzstellungen. Es entsteht etwas, dass ist Deutsch, aber irgendwie auch wieder nicht. Es hatte eine Kraft für sich. Und diese Kraft hört man eben auch bei den türkischen Jungs, die sich ganz anders des Deutschen bemächtigen als wir das tun.
Kann das auch Poesie sein? Im „Wortstoffhof“ beschäftigt sich eine Episode mit DADA und nicht wenige der von Ihnen wiederverwerteten Wortschöpfungen erinnern an Dadaisten wie Tristan Tzara oder Ernst Jandl.
Hacke: Natürlich. Es ist teilweise reinster Dadaismus, wenn ein Satz etwa nur noch über den Klang funktioniert und keine inhaltliche Bedeutung mehr hat. Aber den Dadaismus gab es und den braucht man nicht neu zu erfinden. Er hat viel aufgebrochen, was nur noch Hülse war. Wer damit umzugehen weiß und schräge Wortschöpfungen bewusst benutzt, setzt das schon poetisch ein. Aber ich will nicht übertreiben und das Problem klein reden, dass einige Leute nicht richtig Deutsch können. Es ist im Leben ein unheimliches Hemmnis, wenn einer die Sprache nicht beherrscht. Auf der anderen Seite finde ich es Quatsch, Deutsch ins Grundgesetz zu schreiben. Diese Energie sollte man lieber darauf verwenden, vernünftigen Deutschunterricht für alle, die ihn brauchen, anzubieten. Symbolpolitik nützt doch niemandem.
Sind Sie ein Besserwisser, wenn es im Alltag um Sprache geht?
Hacke: Ich hasse Besserwisserei. Aber natürlich bin ich trotzdem manchmal ein Besserwisser. Wenn im Café einer zwei Cappuccino bestellt, liegt es mir auf der Zunge: Das heißt Cappuccini. Aber ich sag es nicht. Jeder ist doch stolz darauf, wenn er etwas weiß. Und man möchte die anderen wissen lassen, dass man etwas weiß. Bei den Deutschen ist das besonders stark ausgeprägt.
Im „Wortstoffhof“ können ihre Fundstücke wiederverwertet oder weggeschafft werden. Sollten Ihre dokumentierten Neuschöpfungen wie in einem Atlas ausgestorbener Arten erhalten werden oder können sie jetzt ruhig in der Verbrennungsanlage verglühen?
Hacke: Och, darüber mache ich mir nicht so viele Gedanken. Man muss diese Wörter und Sätze jetzt nicht in den Sprachgebrauch eingliedern. Ich habe keinerlei belehrenden Anspruch. Alles, was das Spielerische zerstört, finde ich langweilig. So wie die Leute, die Bücher über alte Wörter wie „Backfisch“ schreiben, um sie zu erhalten. Sprache ist etwas Lebendiges. Wörter kommen und gehen. Wer das nicht merkt, der wird schnell zwanghaft und regelorientiert. Gerade die Deutschen wollen immer alles richtig machen. Wahrscheinlich weil sie ein ängstliches Volk sind. Wenn man Angst vor Veränderung hat, klammert man sich eben an Bestehendes.
Wie könnten die Menschen denn ihre Angst vielleicht verlieren?
Hacke: Indem sie eben solche Sprachspielereien betreiben. Die sind doch nicht gefährlich. Und mit der Veränderung kommt immer auch etwas Neues.

|

Foto: Thomas Dashuber
Gekürzte Fassung des Interviews:

Artikel als PDF-Datei
Hildesheimer Allgemeine Zeitung, 5. Februar 2009
Lesen Sie über Axel Hacke auch:
Schweinespuren im Sand
Axel Hacke erklärt im Vier Linden die Poesie von falschverstandenen Liedtexten und anderen Sprachunfällen

|