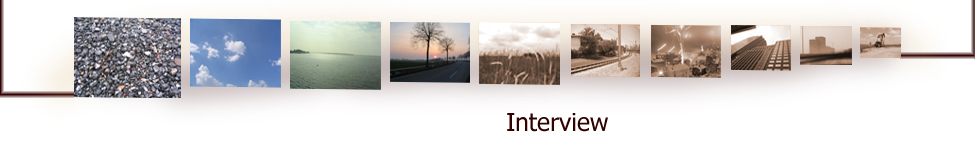| „Die Schizophrenen haben mich immer sehr begeistert“ Frage: „Ich & Ich“ bezeichnen Sie als Klärwerk, als Manifest für die spätere Arbeit. In den späteren Werkkomplexen ist es auch immer wieder so, dass Sie über die Zeichnung zu einer neuen Bildfindung oder einem neuen Konzept kommen, siehe „Innenleben der Dinge“/ „Prosecuritas“ oder andere Zeichnungen, von denen Motive in den „Sonntagsneurosen“ aufgegriffen werden. Ist die Zeichnung eine Form der Suche? Jürgen Klauke:
Die Zeichnung ist ein autarkes Werk, aber die inhaltlichen Strukturen
meiner Arbeit beschäftigen sich mit den gleichen Dingen. Wobei
ich bei der Zeichnung den größtmöglichen Freiraum bzw.
die größtmögliche Freiheit habe. Ein Stück weißes
Papier oder Bütten, das ich beschmutzen kann. Ich komme ja auch
von der Zeichnung. In meinem Studium habe ich Lithografie, Radierung,
also freie Grafik und später auch Malerei und andere Dinge gemacht.
Die Zeichnerei ist der Grundstock meiner Arbeit. Und Sie haben eben
„Ich & Ich“ angesprochen, diese Tagebuchformen, die
sich durch die ganzen 70er Jahre bis 1980 zu dem Buch „Ziemlich“
hinzieht. Das Hin und Her zwischen Foto und Zeichnung, das Sie jetzt
vielleicht meinen, beruht eher auf einer inhaltlichen Struktur, wobei
ich in Zeichnungen Formen oder Dinge finde, die sich dann direkt in
der Fotografie niederschlagen. Ich habe mal davon erzählt, dass
es eine Gouache gab, mit einem stehenden Tisch, darauf lag ein weiblicher
Akt, und der Akt hatte ein Spazierstock zwischen den Schenkeln. Eine
weitere Gouache gab es, da flog ein schräger Tisch durch die Luft,
schon ein bisschen abstrahiert, und darunter hingen solche ballonförmigen
Tropfen, Tränen oder Blasen. Diese zwei Gouachen könnte man
als einen Auslöser für die „Sonntagsneurosen“
nehmen. Also eine formale Sensation wie ein Spazierstock, vielleicht
gedacht als Schwanz oder genitaler Bedeutungsträger, wird dann
plötzlich plausibel, wenn man ihn in etwas anderes transferiert,
im Foto damit arbeitet, also ein Form der realistischeren Darstellung
wählt. Aber die Sensationen werden dann aufgegriffen? Formale Ereignisse oder dass ich einen Gegenstand finde in der Zeichnung, und dann sage, warum gucke ich mir den nicht noch mal anders an. Oder dass ich eine Tischkonstruktion zeichne oder male und plötzlich denke, das wird noch mal was ganz anderes, wenn ich das jetzt in die scheinbare Realität der Fotografie schiebe. „Transformer“ war die „Zeit der Aufräumarbeit“ und in „Dr. Müller’s Sex-Shop oder So stell’ ich mir die Liebe vor“ gehe es um die Abrechnung mit der Erziehung, außerirdischen Instanzen, die einem Dinge verbieten wollen, sagen Sie. Waren Sie in dieser Phase ein politischer Künstler? Weniger ein politisch agierender Künstler, aber schon im sozio-gesellschaftlichen Raum sich bewegend. Als ich Ende 1960 / Anfang 1970 mit solchen Dingen startete, war eine andere Durchsetzungskraft notwendig und es wurden Dinge angekratzt, die entweder Tabu waren oder durch die Erziehung - Gott - scheinheilig abgehandelt wurden. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass dieser direkte politische Teil nicht mein Ding war, sondern ich habe mich erst mal in der Kunst realisiert und dort Ecken und Kanten abgeschliffen, die für mich interessant schienen und die ich weg haben wollte. So sind dann solche Arbeiten entstanden wie „Das menschlichen Antlitz im Spiegel soziologisch-nervöser Prozesse“, „Dr. Müller ...“ oder die ganzen Arbeiten über so ein tierisches Problem wie die Sexualität, was natürlich auf der Hand liegt. Nach den Exzessen der 70er Jahre kam die Langeweile, im Sinne eines Nicht-Mehr-Ertragen-Können. War zu dieser Zeit „Die Lust zu leben“(Fotoarbeit von 1976, in der sich der Akteur Klauke auf unterschiedliche Weise selbst umbringt ) in ihrer ganzen Radikalität zu spüren? So wie ich es in dem
großen Interview (Jürgen Klauke im Gespräch mit Hans-Michael
Herzog und Gerhard Johann Lischka, 1997 – Anmerkung des Verfassers)
mal erklärt habe, die gesamte Kunst der 70er Jahre, von mir und
auch von anderen, war sehr stark am Leben oder auch an solchen Zusammenhängen,
von denen wir eben sprachen, orientiert. Wir haben dementsprechend unter
dem Slogan, wenn man so will, aber auch um was an künstlerischen
Vorstellungen zu ändern, die Ateliers verlassen und standen mehr
auf der Straße oder in Kneipen herum und haben ordentlich mitgelebt.
Das habe ich zum Teil sehr exzessiv betrieben und da kamen die ersten
Langweiler-Momente auf, dass man bestimmte Exzesse oder schöne
Dinge nicht mehr wiederholen kann, dass es irgendwann auch scheitert. Wenn Sie gerade sagen, Sie haben viel gelesen, was andere bereits zu der Langeweile gedacht haben, ist es dann so, dass das Lesen immer die Arbeit begleitet? Das kann man nicht sagen. Aber bei der Langeweile ist so, dass es etwas sehr Abstraktes ist und wenn ich dann auch noch sage „Formalisierung“, das ist ja an sich unmöglich. Das sind künstlerische Griffe, die man da tut. Aber es war schon interessant nachzulesen, was Kirkegaard zur Langeweile sagt. Oder mir hat jemand Cioran empfohlen, ein Nihilist, ein Rumäne, der vor einigen Jahren in Paris starb. Das sind ja Anstöße, die man bekommt. Wie geht ein anderer mit dem Leben um oder wie geht ein anderer damit um. Das sind Interessenlagen, dass man dort mal nachblättert. Es heißt nicht, dass ich ein Philosophiestudiengang einlege, sondern lustvoll mal darin blättere und lese und schaue, was sieht der das, was sieht die das. Aber das macht man nicht explizit bei jeder Werkgruppe, aber Langeweile ist an sich etwas Komisches. Als ich daran arbeitete, stellte ich auch fest, dass es ein riesiges Tabu war, wenn ich andere Leuten darüber befragte, ob es Gleichaltrige waren oder Ältere, die das gar nicht kannten. „Arbeit macht frei“, kann man da nur sagen. So war die Befindlichkeit und dann habe ich darüber gearbeitet. Sie kommen vom Individuellen, auch Selbst – bzw. Grenzerfahrung, zu allgemeinen Positionen, die als „Portrait der Gesellschaft“ gesehen werden können, wie Gerhard Johann Lischka es 1982 charakterisiert hat. Honnef schreibt: „Von der narzisstischen Selbstbespiegelung zur künstlerischen Gesellschaftsdiagnose.“ Doch ein politischer Künstler? Das haben alle gerne gesagt und ich glaube, da ist nicht allzu viel dran. Das Einzige, was dran ist, ist dass die „Formalisierung der Langeweile“ zum Beispiel oder auch einige Arbeiten davor schon, die Thematik, und das ist es vielleicht, was die Herren meinen, allgemein verbindlichere Kodexe oder Standorte hat. Ich bezweifele aber, ob die Langeweile allgemeinverbindlicher ist als das Thema Sexualität oder Männlich / Weiblich, an denen ich etwas gerüttelt habe. Insofern war es immer so, zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit beschäftigt habe und wie ich mich damit beschäftigt habe, also jetzt noch mal Männlich / Weiblich und Sexualität und so weiter, dass es ja auch noch mit Argusaugen betrachtet wurde. Es war ja noch nicht ganz selbstverständlich. Wobei ich nicht der Einzige bin und es auch vorher schon Menschen gab, die mich beeindruckt haben wie Herr Molinier, Herr Bellmer und andere. Aber trotzdem ist da immer so eine Art Schallmauer, damals mehr als heute, beim Betrachter gewesen. Dadurch dass ich noch selbst im Bild fungiere, lustvoll oder abartig, wie die Herrschaften das empfinden von außen, gab es natürlich immer den Moment der Narzissmus-Unterstellung. Und insofern wird es bei der „Langeweile“ ruhiger, es tauchen auch andere Figuren im Bild auf. Ich glaube, das war so der Erlösungsmoment für den einen oder anderen, der mich beobachtete, dass er dann zu solchen Schlüssen kommt, wie Sie in der Frage angesprochen haben. Ich glaube aber, dass die Arbeit über Sexualität genauso allgemeinverbindlich ist. Sie ist vielleicht nur schockierender oder unüblicher gewesen, in dem Zeitrahmen, wo ich das machte. Bei dieser politisch-soziologischen Betrachtung fällt mir dann auch die Arbeit „Antlitze“ ein, bei der Sie seit dem Anschlag auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 Fotos von maskierten Köpfen gesammelt haben. Mir fallen dabei auch die Verschleierungen der afghanischen Frauen ein, die seit der Taliban-Diktatur von 1996 einen Ganzkörperschleier tragen müssen. Da sehe ich dann doch wieder ein Stück politische Kunst, auch wenn hier wieder das Thema Maske und Identität eine Rolle spielt. Das ist das Schöne an der Arbeit. Ich habe ja auch bei „Prosecuritas“ eine Werkreihe, die „Antlitze“ heißt, deswegen hingen die in der Ausstellung (Kunst – und Ausstellungshalle Bonn 23.03.01 – 08.07.01 – Anmerkung d. V.) auch nebeneinander. Die Vermummten heißen auch „Antlitze“, weil ich ihnen ja auch etwas Schönes abgewinne. Die Ästhetisierung, die Ikone, das fast neue Gesicht. Den einen oder anderen kann man sogar zeitlich identifizieren. Den aus München, der oben diesen Strumpf zusammengebunden hat, das ist ja fast eine Ikone. Und auf der anderen Seite hat die Arbeit, was bei Kunst nicht zum Schaden sein soll, mehrere Schichten. Die, die Sie ansprechen hat sie ebenfalls. Und „das ist gut so“, würde der neue Bürgermeister aus Berlin sagen. Sie sehen den Surrealismus als etwas, wo man „anknüpfen und weitermachen“ könnte, gibt es hier Künstler, die Sie besonders beeindruckt oder beeinflusst haben? Und kann man DADA, wenn man sich einige Bildtitel ansieht, nicht auch als Pate ansehen? Gut, aber die beiden
Richtungen fasse ich unter einem Generalbegriff zusammen. Ich spreche
ja auch von den positiven Anteilen des Surrealismus. Im Surrealismus
gibt es ja auch viel Quatsch und Kitsch. Wenn man in Ihrem Werk chronologisch weitergeht, kommt man zu „Prosecuritas“, eine Werkgruppe, die wahrscheinlich am Stärksten im Surrealismus und in der Zeichnung verhaftet ist. Es geht da um gegenwärtige und zukünftige Bildwelten, sagen Sie. Wenn man die Arbeiten „The Big Sleeps“ anschaut, sieht man eine merkwürdig fremde Schönheit. Geht es auch um die? Es ist das, was mich beim Foto interessiert. Ich interessiere mich ja eigentlich gar nicht so für Fotografie. Mich langweilen auch die Sujets der bekannten Fotokünstler, die wir zur Zeit haben, wo Täler, Wald und Höhen, Büchereien, Genremalerei an sich, über Foto noch mal gemacht werden. Das gab es eigentlich alles schon. Ich würde die „Prosecuritas“ - Reihe nicht unbedingt als das Surreellste sehen, sondern ich würde es als eine zeitgenössische mediale Arbeit sehen. Und wenn Sie von einer merkwürdigen, fremden Schönheit sprechen, dann liegt das auch an dem medialen Angang und natürlich wie ich damit umgehe. Ob ich es in dieses astrale Blau tauche, dass es so spacy, so gerade wegfliegend aussieht, oder wenn ich es bei den Schwärzen noch so rauschen lasse. Das sind ja dann technische Möglichkeiten zum Bild zu finden, wie man es gerne hätte. Sie haben aber auch einen sehr starken Bezug in solche virtuelle Vorstellungen, sie haben diese auflösenden Pixelwelten in sich. Das war bei der Arbeit für mich spannend. Dazu kam, dass ich sie letztendlich auf einem analogen Wege löste. Ich also diesen merkwürdigen Gang zum Flughafen und durch die Kofferschächte machte, das Medium künstlerisch unterlaufen habe, denn es dient ja eigentlich dem Zweck der Durchleuchtung, die uns ja auch immer sensibler, oder „gläserner“ – war ja mal das Schlagwort – werden lässt. Das nimmt eher noch zu. Mit den Handys oder was man sich da vorstellen kann. Und heute denkt jeder bei der Arbeit, dass sie mit dem Computer gemacht wurde. Es spielt natürlich
eine Rolle, dass die Durchleuchtungsmaschine schon computerisiert ist.
Wenn man beispielsweise das Bild des Eimers in „Finale“
hat, der von allen Seiten durchleuchtet wurde und dadurch eine optische
Täuschung entsteht. Sicherlich. Ich empfinde es nur so, dass diese Reihe dort am stärksten beheimatet ist. In der Arbeit tauchen auch von Ihnen gesammelte Objekte auf. In den „Sonntagsneurosen“ benutzen Sie dann ganz andere Gegenstände und Objekte. Hüte, Spazierstöcke. Herzog sagt im Gespräch mit Ihnen, sie werden zu eigenständigen Dingen mit auratischem Gefühlswert. Dass das eine oder andere Objekt auratisch wird, das kann schon sein, aber der Gefühlswert ist für jeden etwas anderes. Sie verlieren bei mir ihre normale Gebrauchsanweisung oder Zuordnung. Die verlieren sie auf jeden Fall. Sie werden zu etwas anderem. Wie ich das jetzt beschreiben würde, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Durch die Hüte, Stöcke und Metalleimer kommt doch etwas Bürgerliches mit in die Bilder. Die Stöcke und
Hüte sind natürlich Synonyme für das Männliche schlechthin.
Wir haben ja ein paar schöne Dokumentarfotos, wo die Männer
mit Hüten auf irgendwelchen Plätzen stehen. Und wenn man sich
den Hut genauer ansieht, hat er ja auch etwas von einem Schwanzende,
etwas Genitales. Auf das „Desaströse Ich“ wird im aktuellen Katalog nur wenig eingegangen, dafür an den Arbeiten der 70er und 80er Jahre viele Theorien überprüft. Können Sie sich vorstellen, warum es anscheinend schwieriger ist, Ihre neuen Arbeiten zu greifen? Die Arbeit ist ja jetzt,
wo wir dieses Gespräch machen, noch work in progress. Ich habe
in Paris noch jede Menge neue davon hängen und es liegen jede Menge
Negative in der Schublade. Die Arbeit ist noch gar nicht ausgekostet.
Insofern war bei der Generation Schreiber, die wir im Katalog versammelt
haben, die 70er Jahre das aller Wesentlichste, mit den heute wiederkehrenden
Diskussionen des gender-crossing und was da noch für Begriffe um
die Welt gaukeln. Und insofern hat man das vielleicht ein bisschen vernachlässigt.
Den meisten war es auch noch nicht so zugänglich, wie es dann in
der Bundeskunsthalle hing. Es gab aber einen Kunstjournalisten in der
F.A.Z., der sich damit ganz explizit beschäftigt hat. Jetzt noch mal zu den Performances. Zur Zeit machen sie keine Performances. Performance als Kunstform ist auch noch immer eher in einer Nische vertreten, es sei denn man zählt die Pseudoperformances mit, die einige Theater veranstalten. Liegt es an der fehlenden musealen Verwertbarkeit der Performance Kunst oder schon in der Performance selbst? Sie haben gesagt, Sie möchten das Publikum mit einer geballten Ladung zum Schweigen bringen. Vielleicht ist das Publikum der geballten Sinnlichkeit einer Performance nicht gewachsen. Ich glaube, ich habe
das im Zusammenhang mit der „Hinsetzen/Aufsteh’n“
– Performance gesagt, wo es mir irgendwann gelungen ist, dass
das Publikum still war. Es war ja auch eine einmalig aufgeregte Situation,
die ich so nicht mehr erlebt habe. Performances sind eine Nische, sie
kommen und gehen. Ich möchte
es jetzt noch einmal von einer anderen Seite aufrollen und mit der Identität
anfangen. Ich glaube da unterläuft
Ihnen auch ein kleiner Fehler. Es geht in meinen Arbeiten nicht um eine
ständige Identitätssuche, schon gar nicht um meine eigene
Selbstfindung. Ich habe die „Selbstfindung“ bei „Prosecuritas“
auch eher ironisch gemeint, diesen durchleuchteten Selbstfinder, das
Skelett sozusagen. Aber Sie waren doch persönlich bewegt in den Bildern, das hätte man nicht so gut ersetzen können. Das ich selbst im Bild
war, darüber habe ich viel gesprochen. Die Frage ist nur, ob ich
Ihnen da jetzt was Neues sagen kann. Weibel spricht
davon, dass Subjekt, Geschlecht, Sex, Körper und Identität
bei Ihnen eine offene Gleichung sind. Durch das Spiel mit der sexuellen
Ambivalenz wird die Opposition der Geschlechter als Fiktion entlarvt.
Geschlecht an sich wird als kulturelle Produktion dargestellt. Vieles. Also es gibt
ja Arbeiten, die regelrecht das Männliche denunzieren. Wenn Sie
die Arbeit nehmen „Das ewig Männliche – als ewig Langweiliges“
und es gibt auch andere Arbeiten. Es gibt aber auch diese schönen
Arbeiten, die ich als Geschlechterannäherungen bezeichne. Es gibt
aber nie den Moment, wo Herr Klauke Transvestit oder Frau sein möchte.
Sondern der Herr Klauke spielt genau mit diesem brüchigen Moment,
wo das Männliche, aber genauso gut könnte es das Weibliche
sein, sich Anteile des anderen nimmt und damit spielt. Wenn wir uns
alle selbst abfragen, wie viele feminine Anteile wir in uns tragen oder
eine Frau sich fragt, wie viele maskuline Teile sie in sich trägt,
dann müssen die nicht alle umgebaut werden. Es gibt diesen Wunsch
bei dem einen oder anderen. Aber ich finde diese Anteile schön.
Und dann gibt es die äußere Hülle, also die Ästhetisierung
des Weiblichen, die mich natürlich auch sehr interessiert hat,
im Zeichen der Schönheit oder die Möglichkeiten, die sich
ein Mann genau so aneignen kann, ohne all das bestätigen zu müssen,
was die Subkultur auch schon hatte. Dass man schwul ist oder Transvestit
wäre oder dass man umgebaut werden möchte. Sondern dass man
einfach sagt, nimm’ mich. Und nähere mich auf diesem Weg
dem an und gehe anders damit um. Im Gespräch mit Hans-Michael Herzog und Gerhard Johann Lischka sprechen Sie von dem spielenden Kind in Ihnen. „Ohne das Spielerische, Beiläufige läuft nichts.“ Aber durch das Spiel eines Erwachsenen entstehen eben keine kleinen Sandkuchen, sondern eher große Sandburgen, durch deren Labyrinth man sich wieder durchkämpfen muss. Welche Spiele treibt Ihr Kind? Wie ich eben auch ganz gerne Männer mag, bei denen ich merke, dass sie einen femininen Anteil haben, mag ich eben auch Erwachsene, die noch ein paar kindliche Strukturen zulassen. Das meint aber nicht kindisch, und ich denke damit ist es geklärt. Dieses Spielerische, einfach mal kindlich im besten Sinne sein zu können, als immer dieses männliche oder weibliche Gehabe, was immer so eine bestimmte Ernsthaftigkeit und Struktur erzeugt, die das Erwachsensein so mit sich bringt. Also das man mal ohne weiteres richtig saublöd sein darf und sich dadurch anderen Dingen öffnet. Ich glaube, das kann man auch sonst nicht. Man muss sich diese kindliche Neugier bewahren, als Künstler. Es gibt ja auch eine kindliche Nicht-Angst, auf Dinge zuzugehen. Es gibt als Kind eine andere Angst vor Größen oder Dunkelheit, aber Kinder, wenn sie jetzt nicht schon Psychopathen sind, gehen doch manchmal auf Dinge viel lockerer zu und so etwas sollte man sich erhalten. Das meine ich, wenn ich auch im Text „Zeitlebens“ sage: „Das Kind kurvt immer noch in mir“. Im Film „Eine Ewigkeit – ein Lächeln“ sieht es so aus, als hätten im Studio bei den Arbeiten zu der „Formalisierung der Langeweile“ auch kleine Performances stattgefunden. Ging es in dieser Phase eher darum vor der Kamera zu agieren und anschließend die Bilder auszuwählen oder war es in erster Linie eine Einzelbild-Inszenierung? Das ist für Sie
vielleicht interessant. Die Fotoarbeit „Formalisierung der Langeweile“
wurde im Fotostudio gemacht und dann hatte ich einen Freund, der schon
mit Video im professionellen Bereich arbeitete. Ich sagte zu ihm, wir
machen einen Film über die Langeweile, wo wir das in Bewegung setzen.
Also wir spielen die Fotos, die schon fertig waren, noch mal nach. Um
eine Bewegung da reinzubringen und einen Film darüber zu machen.
Der Film heißt „Formalisierung der Langeweile“ und
kein Fernsehsender will ihn haben, weil er ihnen wahrscheinlich zu langweilig
ist. Wir haben es schon mal angeboten, aber der ruht noch. Er wird aber
hier und da mal gezeigt. Und Sie haben gesagt, am letzten Arbeitstag wird das Studio zerlegt. Was passiert in dieser Phase? Das ist etwas forsch gesagt. Ich meine damit, am Ende wird das Risiko erhöht. Dass etwas zu Bruch geht oder dass wir Schaden anrichten zugunsten der Bilder. Entstehen dann wirklich noch einmal ganz andere Sachen? Ja. Im Studio entstehen ohnehin noch einmal ganz andere Sachen als ich sie geplant habe. Prozentual sage ich immer, 60 Prozent sind sicher und 40 Prozent kommen durch die Inspiration mit den Menschen und Gegenständen, die man dann vor sich hat, leibhaftig. Und später bei der so genannten Risikoerhöhung kommt dann, was man auch „den Zufall für sich brauchbar machen“ nennt. Das ich dann zum Beispiel sage, lass das mal aus 10 Meter runterfallen und mal gucken, was passiert. Nun möchte ich noch einmal zu den Bildtiteln kommen. Sprache und die dadurch entstehenden neuen Bedeutungsebenen sind Ihnen sehr wichtig. Ironische oder auch poetisch gebrochene Titel kommen immer wieder vor. Wollen Sie den Wörtern ihre Kraft zurückgeben? Für mich haben Wörter mehr als nur ihre Bedeutung. Je nachdem wie man sie spricht, je nachdem in welchen Kontexten man sie bringt. Wir haben ja die berühmten Sprüche: „Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter“, und das habe ich in einem Interview für mich mal in Frage gestellt. Ich versuche mit Sprache umzugehen, weil es mir Spaß macht und ich es als Begleitinstrument für die Bilder für wichtig halte. Ich spreche dann auch vom Sound eines Wortes bzw. vom Raum eines Wortes. Sie sagen, Sie benutzen „Körper als Bildträger, als Sprache“ bezogen auf die Arbeiten Anfang der 70er Jahre. Der Körper im „Desaströsen Ich“ wird dagegen eher zum Objekt, zum Material. Uwe M. Schneede geht im Katalog „Absolute Windstille“ soweit, die Körper als „Klumpen Fleisch“ zu beschreiben. Die regalartig gelagerten Körper in „Entscheidungsnotstand“ mögen diesen Aspekt haben, aber in der „Annäherungsakrobatik“ geht es doch um ein ganz anderes Körperbild. Eher der Körper als ästhetisches Objekt. Ich als Künstler, im Gegensatz was die Theorie dazu sagt, würde sagen, es gibt immer Begrifflichkeiten, die in einer bestimmten Zeit geboren werden. In den 70er Jahren wurde eben Körpersprache, body-language, Alphabet des Körpers und so weiter geboren. Trotzdem würde ich sagen, dass bei den „Entscheidungsnotständen“ Herr Schneede schon Recht hat, wenn er von einem Stück Fleisch spricht. Das meine ich da auch. Und trotzdem haben die Körper, insbesondere bei den Stelen, den geöffneten Schenkeln, auch eine Körpersprache. Die ist jetzt nicht mehr in der Zeit, als das eine Begrifflichkeit war, sondern es zieht einfach weiter. Ich habe body-language mit kreiert, wenn man so will und verwende es heute auch noch. Es erscheint nur in anderen Bildern und ist nicht mehr 1970 und das ist auch richtig. Ich würde sowohl Herrn Schneede Recht geben, ich würde aber trotzdem sagen, bei der „Annäherungsakrobatik“, wenn der nette Surfer mit seinem stabilen Körper die Waage macht, was ich ja gar nicht könnte, dann ist das auch eine Körpersprache. Eine absolute, rigorose sogar, die nur das meint, was da jetzt ist. Diese Balance. Die Balance geschieht natürlich oberhalb einer Frau, die durch eine Tischplatte getrennt ist. Also da geht es dann um Schichten, die angesprochen werden für den Betrachter. Ich würde die Körpersprache schon als ein Instrument sehen, mit dem ich immer weiter gearbeitet habe. Es ist genau wie die Frage, machst du heute noch Performance. Oder als die wilde Malerei tobte, fragten die Kollegen mich in Hamburg, machst du immer noch eine Performance. Das war für die vorbei: „Jetzt wird doch gemalt, das ist doch kindisch“. Die Arbeit „Gefühlspfütze“ aus dem „Desaströsen Ich“ erinnert an die Körperdarstellungen Francis Bacons? Ja, könnte sein. Die Arbeit zählt mit zu den Arbeiten, die im Studio entstehen. Ich kann mich genau daran erinnern. Hier wird genau dieser Zufall nutzbar gemacht. Die Frau versucht sich gerade da unten reinzuzwängen und ich sage, bleib so und KLACK! Und da sind zwei, drei Bilder entstanden, die „Gefühlspfütze“ ist eines der schönsten davon. Es hat mit so etwas zu tun. Ist aber nicht entstanden, dass man sagt, ich mache eine Hommage an Bacon, sondern so, wie ich erzählt habe. Wenn man heute von Körper spricht, muss man den virtuellen Körper immer mitdenken. Vor kurzem stand in der Süddeutschen Zeitung im Zusammenhang mit den neuesten Animationsfilmen, man müsse über die Beseelung dieser computergenerierten Wesen nachdenken, denn ihr Handlungsspielraum wird immer größer. Bezogen auf den „Prosecuritas“–Zyklus sprechen Sie davon, dass es zu einer Bewusstseinsveränderung kommen wird, wenn man die Maschinen ungehindert weitermachen lässt. Die Sicht auf die Welt, ist jetzt schon verrutscht, heißt es bei Ihnen weiter. Was beobachten Sie da? Gerade hat ein Amerikaner
für mich einen Text geschrieben, für einen kleinen Katalog
in Spanien, und der schrieb am Ende, dass ich vielleicht ein letztes
Aufbegehren zeige. Gegen das, was da käme. Durch meine körperliche
Präsenz oder indem ich mich mit dem Körper beschäftige.
Aber das ist ja geradezu in den letzten Jahren als Zeit- oder Modeereignis
abzulesen gewesen. Die Postmoderne hat den Köper abgemeldet und
plötzlich beschäftigen sich alle Künstler mit dem Körper.
Es gab ja nie so viele Körperausstellungen oder Künstler,
die den Körper inszenierten, malten und und und. Oder jemand wie Stelarc, der die Entwickelungen und Maschinen für sich nutzbar macht. Das ist ja noch mal
was ganz anderes. Anbauten, der künstliche Körper oder den
Körper erweitern. Dinge der Körpererweiterung, die ich 1970
auf eine andere Art mit den Sexualorganen, männlich / weiblich
und in der „Self Performance“ gemacht habe. Wobei er in
so eine Maschinenentwicklung geht. Ihr Arbeitsfeld ist unsere „verkappte, wahnsinnige Existenz“. Wie kreisen Sie die Existenz ein, um an ihren Kern zu kommen? Sie haben sich als Randgänger bezeichnet, der sich von den äußeren Schichten nach innen vortastet. Das ist auch nur so zu beschreiben, dass jeder Künstler bestimmte Neigungswinkel hat und meine waren früh so angelegt. Auch als ich noch nicht auf der Kunstschule war. Das heißt, als ich an die Kunstschule kam, musste ich nicht darüber nachdenken, was ich da tue. Ich hatte Freunde, die waren technisch begabter als ich, die fragten mich immer, was soll ich machen. Und zeichneten irgendeine Fischgräte oder eine alte Frau am Meer wie Käthe Kollwitz oder so was, aber hochgradig begabt. Malten Bilder, irre, in einer halben Stunde, Stilleben, Öl, Essig, Amphibolin, dann waren die fertig und gingen ein Bier trinken, da war ich immer noch am herumdoktern. Aber ich hatte nie ein Problem über eine Struktur in sich, die man ja auch braucht, um Bücher zu schreiben oder Bilder zu malen, den Künsten nachzugehen, auf welchem Feld auch immer. Da liege ich halt so, wenn ich sage, ich kreise um die menschliche Existenz, mit all diesen Fragen. Die Fragen ändern sich ja auch von Zeit zu Zeit. Wir haben eben vom Ist-Zustand gesprochen, über Klonen, wie die Medien auf uns wirken, wie wirkt der Film auf die Menschheit, wie wirkt das überhaupt schon, wissen die überhaupt noch, was sie da sehen, ist es noch Realität oder ist es schon virtuell und so weiter. Und das ändert natürlich auch die Verfahrensweisen darüber nachzudenken. Insofern ist auch eine Arbeit wie „Prosecuritas“, wenn sie das jetzt auch nicht illustriert, schon eine Arbeit, die mit solchen Dingen in unserer Zeit, über einen anderen technischen Angang, augenscheinlich im Moment mehr zu tun hat als vielleicht das „Desaströse Ich“ sogar. Wobei das „Desaströse Ich“ vom Inhaltlichen oder was dann in Schichten beim Betrachter angesprochen werden kann, wie ich schon gesagt habe, wenn er Willens ist, natürlich auch wieder Momente aufzeigt aus unserer Zeit, die ich eben versucht habe anzusprechen, wo das bei mir herkommen kann. Es ist nicht so 1:1 definiert, das mache ich jetzt deshalb. Sondern es kommt aus einem großen Haufen von Gedankengängen, die sich im „Desaströsen Ich“ dann wieder finden mit den diversen Untergruppierungen. Sie wünschen sich „Anarchie für die Kunst“. Ist der heutige Kunstbetrieb wirklich so fremdbestimmt? Der Kunstmarkt? Er ist organisierter als er jemals war. Es gibt eben diesen Kunstmarkt. Wir müssen damit leben. Es gab immer einen Markt, aber heute ist er fast ein stock market oder Aktienmarkt. Künstler werden immer jünger zu Shootingstars, die dann wieder verschwinden. Sie sind wie Markenartikel, die durchgereicht werden. Es ist schon eine andere Situation als wir sie vor 30, 40, 50 Jahren hatten. Kunst war immer ein Gegenstand, den jemand haben wollte, haben musste oder auch nicht. Und da wurde ja auch immer bezahlt in einer Form. Den Handel gibt es also schon länger, aber heute haben wir eben einen richtigen Markt, der Gesetze und Gesetzmäßigkeiten hat, die natürlich auch zu einem Verschleiß führen bei den Dingen. Meine Abschlussfrage: Gibt es etwas, was Sie noch nicht gefragt wurden, aber einmal gerne sagen würden? Ob in diesem oder einem anderen Interview. (lacht) Das ist gut. Tja, habe ich jetzt im Moment nicht. Dafür komme ich aus einer anderen Hemisphäre zu Ihnen. Ich habe jetzt so gut es geht, die Sachen beantwortet. Ich könnte irgendeinen Stuss erzählen, aber dass wäre ja Quatsch. Vielleicht hätte ich jetzt gerade etwas gehabt, aber heute morgen waren die ganze Zeit Leute um mich herum. Vielen Dank für das Interview.
|
Bild-Quelle und weitere
Informationen zur retrospektiven Dieses
Interview wurde am 19.07.01 in Köln geführt Es wurde
nur sehr behutsam bearbeitet
|