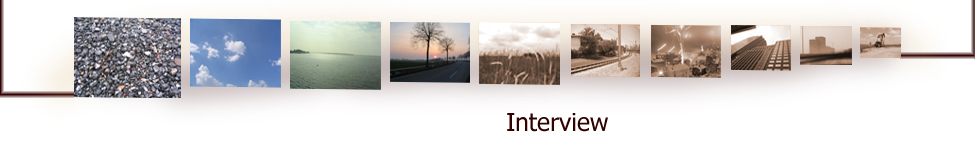| „Am
Set bin ich der Chef“
Am 9. September
2005 in Peter Lichtefelds Wohnung in Berlin Wilmersdorf. Im Arbeitszimmer
zwischen zwei großen Schreibtischen steht ein knochiger kleiner
Holztisch. Eine Wand voller Bücher, eine halbe voller CDs. Es gibt
Tee und Wasser während der Regisseur über seinen letzten Film
„Playa del Futuro“, Hierarchien bei Film und Fernsehen und
Buddhismus erzählt. Auf dem Balkon flattern an einer Wäscheleine
bunte Fähnchen.
Was sind das
für Fahnen?
Das sind tibetische Gebetsfahnen. Auf ihnen stehen Weisheitssprüche.
Der Gedanke ist, dass sie sich durch Wind und Wasser auswaschen.
Was passiert
mit dem Gebet, wenn es ausgewaschen ist?
Es wird in die Welt getragen.
Ihren neuen
Film „Playa del Futuro“ leiten Sie mit einem Zitat des Lamas
Sogyal Rinpoche ein („Es ist wichtig, dass wir keine Zeit verschwenden.
Das Leben ist kurz und die Dinge sind vergänglich.“). Was
für eine Bedeutung hat der Buddhismus für Ihr Schaffen?
Keine einfach zu beantwortende Frage. Auf jeden Fall: durch meine buddhistische
Praxis verstehe ich immer mehr, dass man sein eigenes Glück nur
in sich selber finden kann, dass es nur sehr bedingt von äußeren
Umständen abhängt, ob man glücklich ist oder nicht. Ein
anderer Gedanke ist, dass das Leben und alles was es ausmacht, einschließlich
uns selbst, vergänglich ist. Daraus kann man die Erkenntnis ableiten,
dass es keinen Sinn macht, Dinge auf später zu verschieben. Deshalb
das Zitat. Na ja, da könnte man viel drüber sagen...
Was halten
Sie von Hierarchie? Beim Film?
Wenn es die nicht gibt, kommt man zu nichts. Für mich wäre
es ideal, es indianisch zu organisieren. Indianisch heißt, alle
diskutieren so lange, bis es eine einstimmige Meinung gibt. Egal ob
es zwei oder hundert Leute sind. Aber das funktioniert beim Film nicht.
Vor allem in einer Welt, in der die Zeit eine so große Rolle spielt.
In der Realität sieht es so aus: Am Set bin ich der Chef. Das muss
einfach klar sein. Das heißt ja nicht, dass man seine Mitarbeiter
nicht achtet, ihnen nicht auch Verantwortung gibt. Natürlich. Ich
will ja schließlich meinen Mitarbeitern vertrauen können.
Letztenendes muss ich jedoch entscheiden, weil ich eben der Verantwortliche
bin.
Sie haben Fernsehfilme
für SAT 1 und das ZDF, verschiedene Staffeln für die RTL-Serie
„Die Camper“ und zwei eigene Kinofilme gedreht. Bei diesen
Arbeiten gibt es doch sicherlich große Unterschiede in den Hierarchien?
Ein Fernsehauftrag ist schon etwas grundsätzlich anderes. In meinem
Arbeitsvertrag heißt es da, dass ich weisungsgebunden bin. Wenn
mir einer sagt, du musst die Nahaufnahme einer Tasse drehen, dann mach’
ich das. Das sagt zwar keiner. Aber der Auftraggeber könnte es
sagen. Weil er dafür sorgen will, dass das Produkt am Ende so aussieht,
wie er es haben möchte.
Ich fand die Situation bei den beiden Fernsehfilmen nicht einfach. Am
Set bin ich zwar der Chef, wenn aber der Vertreter der Firma, der Producer,
dabeisitzt, ist er – eigentlich - mein Vorgesetzter. Theoretisch
könnte man mich sogar rausschmeißen.
Ist Ihnen so
etwas schon passiert?
Ja, ich wurde einmal entlassen. Das war mein erster Fernsehfilmauftrag
nach meinem ersten Kinofilm "Zugvögel". Die Firma hatte
mich nicht engagiert, weil sie „Zugvögel“ so toll fanden,
sondern weil sie Peter Lohmeyer für die zweite Hauptrolle gewinnen
wollten. Der hatte das Buch abgelehnt. Lohmeyer sagte jedoch, wenn ein
Regisseur wie der Lichtefeld das umschreiben und inszenieren würde,
könnte er sich vorstellen, mitzumachen. Ich bekam einen Vertrag
und das Drehbuch wurde unter meiner Aufsicht umgeschrieben. Und als
keine Einwände gegenüber dem umgeschriebenen Buch kamen, haben
wir angefangen zu drehen.
Wer war sonst
noch beteiligt?
Die Hauptrolle spielte Harald Juhnke. Ich war zuerst ganz schön
aufgeregt, mit ihm zu arbeiten. Er war immerhin ein Star. Ein supernetter
Mensch, ohne Allüren, der aber in einer anderen Welt voller Ruhm
und Geld lebte. Er war sehr lustig, aber nicht leicht zu bändigen.
Als Regisseur hat er mich von Anfang an akzeptiert.
Ist es Ihnen
leicht gefallen, Harald Juhnke Anweisungen zu geben?
Ja. Bevor man anfängt zu drehen, lernt man sich kennen und da war
klar, der Mann ist nett, mit dem kann man reden. Vielleicht war ich
vorsichtiger und höflicher als sonst...
Aber wie kam
es dann zu der Entlassung?
Am dritten Drehtag sagte der Aufnahmeleiter zu mir, ich soll um 12.30
Uhr beim Produzenten im Büro sein. Das habe ich überhaupt
nicht verstanden. Selbst Harald sagte: „Was will der denn, der
alte Meckerkopp.“
Der Produzent erklärte mir, ich müsste mehr mit der Kamera
fahren. Ich habe versucht, meine Arbeit zu verteidigen, aber er meinte,
beim Fernsehen müsste man eben mehr fahren. Und die Landschaftsaufnahmen
wären auch falsch. „Sie müssen Köppe drehen!“
Also hat mir der Produzent gesagt, ich hätte Mist gemacht. So etwas
kannte ich nicht. Bei „Zugvögel“ habe ich es gemeinsam
mit meinem Team eben so gemacht, wie ich es mir vorstellte.
Die Einladung ins Produzentenbüro passierte in zwei Drehwochen
noch dreimal. Am Ende sagte er, ich soll einen Rohschnitt machen, den
der Herstellungsleiter dann der Redakteurin Doris Heinze zeigte. Als
sie die Aufnahmen gesehen hatte, stoppte sie den Dreh und damit war
ich faktisch entlassen. Na ja, Redakteure als Vertreter der auftraggebenden
Sender haben eben Einfluss.
Haben Sie noch
ein Beispiel?
Bei der SAT 1. Produktion „Verdammte Gefühle“ sollte
bei einer Schnittmontage „Riders On The Storm“ von den „Doors“
laufen. Das stand so im Drehbuch. Die Redakteurin meinte aber bei der
Tonmischung, das geht nicht. Die „Doors“ gehen einfach nicht.
Da gab es nicht mal eine Begründung. Also kam da ein anderer Song
hin. Durch solche Dinge wird das Endprodukt natürlich stark beeinflusst.
Ob ich dann noch sagen kann, das ist mein Film, naja... Ich glaube kaum,
dass ich für SAT 1. noch mal einen TV-Film machen werde.
Fühlen
Sie sich in der Künstlerseele gekränkt oder nicht respektiert?
Nö. Und gekränkt sowieso nicht.
Bei „Die Camper“ ist der Einfluss ein anderer. Da ist der
Producer auch der Hauptautor. Es passiert schon mal, dass er zu mir
kommt und sagt, ihm wäre es wichtig, dass Willy Thomczyk eine Szene
so oder so spielt. Da kann ich mich angegriffen fühlen oder für
den Rat dankbar sein. Wir haben uns gut verstanden. Entweder habe ich
ihn oder er mich überzeugt. Und manchmal hab ich zwei Varianten
gedreht. So ist das vollkommen in Ordnung.
Wie kamen Sie
überhaupt zu der Serie „Die Camper“, für die Sie
schon einige Staffeln gedreht haben?
1999 hab ich die ersten Folgen gedreht. Vorher gab es schon eine Staffel.
Als ich einstieg, wollten sie jemand ganz Neuen, der noch nie Fernsehen
gemacht hat. Die Producerin Elke Lumann kannte mich und mochte „Zugvögel“.
Beim zweiten Gespräch haben wir gemeinsam mit der Produzentin zwei
alte Folgen angesehen und ich sollte meine Meinung sagen. Ich wusste,
ich brauche den Job und das Geld und wollte mich auf jeden Fall richtig
verhalten. Aber die Produzentin redete Tacheles, also tat ich das auch.
Ich kritisierte das Gedrehte und erklärte, wie ich es machen würde.
Sie waren einverstanden.
Ist die Atmosphäre
am Set von „Die Camper“ anders als bei den Fernsehfilmen?
Da ist alles Friede, Freude und prima. Und am Schluss freuen sich alle.
Wie eine Großfamilie. Nur das die Streits und Kräche nicht
so ernst sind wie in echten Familien.
Und Ihre Stellung?
Bei Serien sind Regisseure nicht so wichtig. Ich bin zum Beispiel bei
der gesamten Postproduktion nicht dabei. Dennoch habe ich die Verantwortung.
Wenn etwa die Kostüme am Ende nicht gut aussehen, trage ich dafür
die Verantwortung und nicht die Kostümbildnerin. Ich bin für
das verantwortlich, was am Ende zu sehen und zu hören ist.
Wie ist es
denn bei Ihnen mit der Schauspielerführung? Sie haben gesagt, am
Set sind Sie der Chef.
Beispiel: Wir drehen eine Szene, wo einer von einem anderen interviewt
wird. Mit dem Kameramann habe ich festgelegt, wo die beiden am Tisch
sitzen. Einer trinkt Tee und einer Wasser. Diese Dinge sind festgelegt.
Mit den Schauspielern wird die Szene dann geprobt und der Interviewte
sagt: „Mensch, kann ich nicht aufstehen?“ Bei den Campern
wäre es so, dass ich zu Willi Thomczyk sagen würde, dass wir
dann eine Einstellung mehr drehen müssen, wenn er aufsteht. Sofort
würde er einen Weg finden für seine Rolle, um sitzen bleiben
zu können. Peter Lohmeyer würde dagegen vielleicht den Stuhl
zur Seite schieben und sagen: „Wieso brauchen wir überhaupt
einen Tisch?“ Dann muss ich schnell eine Antwort haben. Entweder
ich habe eine gute Antwort oder ich sage: „Peter setz’ dich
bitte hin, wir versuchen das jetzt mal so.“ Inszenieren ist also
mehr eine Kommunikation, die auch auf den Charakter des Schauspielers
eingehen muss. Letztendlich sage ich aber, wie wir es machen.
Fällt
Ihnen das immer leicht?
Nein, nicht immer. Schwierig ist zum Beispiel, wenn ein Schauspieler
den ersten Tag hat. Dann muss man sich um ihn kümmern, ihm zeigen,
wie wichtig er ist. Ohne einen Affen zu machen. Man muss authentisch
bleiben.
Sie sind also beim
Drehen flexibel? Es geht Ihnen nicht darum, Ihr Drehbuch haarklein umzusetzen?
Nein, nur die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich suche mir ja
auch die Schauspieler danach aus, dass ich mich mit ihnen konstruktiv
auseinander setzten kann – und auch ein Bier trinken gehen kann.
Also Kommunikation ist wichtig, aber nicht jeder Beleuchter darf seine
Meinung zu einer Szene sagen.
Serie, Fernsehfilme,
Kinofilme. Wie ist es die Gewichtung Ihrer Arbeit?
Ich habe mich in diesem Jahr zwei Monate mit den Campern befasst. Inklusive
allem. Bücher lesen, diskutieren, Schnitt, etc. Sechs Folgen habe
ich gedreht. Bei einem Fernsehfilm bin ich vielleicht dreieinhalb Monate
beschäftigt. Mit „Playa del Futuro“ war ich dagegen
fünf Jahre befasst.
Sie verdienen
also Ihr Geld eher mit Projekten, an denen nicht unbedingt Ihr Herz
hängt.
Ohne Fernsehen ist es eben schwierig. Als Freischaffender musst du sehen,
wie du Geld verdienst, ohne dass du irgendeine Scheiße machst.
Das ist das Ziel. Ich habe das nicht mit den Kinofilmen geschafft, aber
mit den Campern. Ohne „Die Camper“ hätte ich den zweiten
Kinofilm nicht machen können. Wobei auch mein Herz an den Campern
hängt.
Das Wichtigste ist, dass man Ziele hat. Und die dürfen nicht monetär
sein. Sich etwas anzuschaffen und in Abhängigkeiten zu begeben,
ist nicht meine Sache. Wenn man das akzeptiert und dort sein Glück
sucht, wo es zu finden ist, wird man zufriedener.
Aber Sie würden
doch sicherlich auch gerne mit Ihren eigenen Filmen Geld verdienen?
Ich habe beschlossen, bei meinem nächsten Kinoprojekt will ich
Geld verdienen. Es ist diesmal auch eine andere Produktionsfirma. Bei
„Playa del Futuro“ habe ich gar nichts verdient und bei
„Zugvögel“ ein ganz kleines bisschen.
Kommen wir
mal zur Eisenbahn. Wie steht es mit Ihrer Leidenschaft zu Zügen?
In „Zugvögel“ ist die Bahn und das Reisen zentrales
Element. Auch in „Playa del Futuro“ ist der Bahnhof ein
wichtiger Fixpunkt der Geschichte.
Ich war ein Autokind. In unserer Siedlung war unser Auto das einzige.
Mit der Oma bin ich irgendwann mal Zug gefahren und das war total aufregend.
Ich habe als Kind viel mit einer Eisenbahn gespielt, die mein Vater
für mich selbst gebaut hat. Mit zehn Jahren hatte ich neben mir
den Atlas liegen und bin die Strecken der Bundesbahn abgefahren. Der
Zug fuhr natürlich immer nur im Kreis. Tag und Nacht. Oder ich
habe Straßenbahn mit Haltestellen in der Küche gespielt.
Meine Mutter durfte nirgends hintreten.
Ich bin auch später in meiner Heimat Dortmund gerne Straßenbahn
gefahren und meine erste Reise ohne Eltern war mit Interrail. Da war
ich 18 und das war damals etwas Besonderes.
Es gab sogar eine Phase, in der ich richtiger Autofeind war. Heute finde
ich es toll, dass ich einen kleinen Wagen vor der Tür stehen habe,
es mir aber dennoch leisten kann, meistens mit dem Zug zu fahren.
Das ist Luxus.
Genau. Das ist für mich Luxus und Freiheit. Ich kann mich entscheiden.
Andere haben das Problem, zwei Autos zu besitzen und die müssen
dann überlegen, welches sie jetzt benutzen. Ich mag es auch, die
Verkehrsmittel zu wechseln. Ich kenne meine Frau jetzt 20 Jahre und
unser letzter Urlaub war der erste mit dem Auto. Ich finde es schön,
wenn man offen ist.
Sie haben Politologie
und Geografie studiert und sind vom Ruhrgebiet nach Berlin gegangen.
Wann sind Sie nach Berlin gezogen?
Vor 25 Jahren. Ich kam aber von Gießen nach Berlin. Da habe ich
bis zum Vordiplom studiert. In Berlin habe ich das Studium dann beendet.
Wie kam der
Wechsel zum Film?
Ich wollte immer zum Film, habe mich aber nie getraut, mich auf einer
Filmhochschule zu bewerben. Jetzt bin ich froh, dass ich nicht da war.
Über Umwege habe ich mal bei einem Studentenfilm Aufnahmeleitung
gemacht und dabei erst kennen gelernt, was das eigentlich ist. So bin
ich in die Branche reingekommen. Meinen ersten bezahlten Job als Aufnahmeleiter
hatte ich 1992 bei Marcel Gislers „Die blaue Stunde“. Irgendwann
kam die Idee, ich will ein Drehbuch schreiben. Ich bin da wirklich Autodidakt,
deswegen hat es auch etwas länger gedauert.
Wie war das
genau?
An „Zugvögel“ habe ich lange geschrieben. Natürlich
weil ich nebenbei viel gearbeitet habe. Als Aufnahmeleiter verdient
man nicht so viel. Ich habe auch gebraucht, weil ich beim Schreiben
erst mal gelernt habe, wie man schreibt. Learning by doing. Mehrere
Jahre hat mich das begleitet. Und dann hat es wiederum gedauert, jemanden
zu finden, den das interessiert. Ich habe sogar noch selbst eine Dramaturgin
bezahlt. 1996 haben wir schließlich „Zugvögel“
gedreht.
Sie sind also
sehr naiv an das Projekt gegangen?
Na ja, die Filmwelt kannte ich natürlich schon, weil ich dort arbeitete.
Alle wussten, dass ich schreibe und haben etwas herabblickend gesagt:
„Oh, der Peter schreibt. Na schauen wir mal...“ Das hat
mich vielleicht geärgert, aber vor allem motiviert. Ich komme ja
aus einem Arbeiterelternhaus, aus Dortmund. Das Wohnzimmer war eben
nicht von Büchern bestimmt. Bei uns hieß es eher: „Vom
Lesen bekommst du eckige Augen.“
Von zu Hause habe ich vor allem mitgenommen: „Steh’ zu dem,
was du bist.“ Und ich habe ja zuerst nicht die künstlerische
Laufbahn eingeschlagen. Ich bin jetzt eben Diplom-Geograf. Aber ich
habe das zu Ende gebracht, das ist mir wichtig. Ich habe nie in dem
Beruf gearbeitet, aber ein bisschen spielt das trotzdem in meinen beiden
Kinofilmen eine Rolle. Mir ist es wichtig, bei einem Film zu sehen,
wo er spielt. Es gibt Filme, die behaupten, sie würden in Köln
spielen, aber ich sehe und spüre das nicht.
Ein Kritiker
hat über eine Szene von „Playa del Futuro“ geschrieben,
dass die Kölner Eckkneipe so authentisch ist, weil der für
Mülheim typische Flugzeuglärm zu hören ist.
Genau. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber das war nicht meine
Idee. Durch Zufall hat die Sounddesignerin von dem Flugzeuglärm
in Köln Mülheim erfahren und mir vorgeschlagen, den zu benutzen.
Das finde ich toll, wenn ein Ort authentisch wird.
Wie war es
bei Ihren beiden Filmen mit den Drehorten Inari und dem verlassenen
Bahnhof in Andalusien?
Den Ort für „Zugvögel“ habe ich allein gefunden
und mir war es natürlich wichtig, dort zu drehen. Als ich mit Kameramann
Frank Griebe dort hinfuhr, hab ich mir vorher ausgemalt, wir kommen
da nach einer sehr langen Fahrt an und er sagt: „Warum sind wir
denn jetzt soweit gefahren? Das hättest du doch auch irgendwo in
der Eiffel drehen können.“ Ein Kameramann hat eben einen
anderen Blick. Aber er war vollkommen begeistert.
Und bei „Playa
del Futuro“?
Ich bin mit meinem Freund und Cutter zwei Wochen durch Spanien gefahren.
Ein entlegener Bahnhof – das mussten wir finden. Und dann dieser
Bahnhof bei Guadix. Welch ein Traum. Ein so genanntes 360° Set.
Du kannst in alle Richtungen drehen und es passt.
Die Landschaftsaufnahmen
sind in dem Film dann auch sehr wichtig geworden. Fehlt „Playa
del Futuro“ dagegen nicht der lakonische Witz, der „Zugvögel“
so auszeichnete?
Wir haben „Zugvögel“ nie unter dem Aspekt gedreht,
komödiantisch sein zu wollen. Aber die Kritik hat den Film als
Komödie aufgefasst. Wenn es jetzt bei "Playa..." nicht
so lustig geworden ist, dann ist es so.
Komödie
trifft es eigentlich nicht. Es ist ein melancholischer Humor. Die Szene
in „Zugvögel“ wenn Kati Outinen und Kari Väänänen
mit Joachim Król im Zug nach Finnland fahren, trinken und reden,
ist einer der besten Momente im Film. Darin steckt die ganze Stimmung
des Films.
Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen und von Joachim Król.
Wie auch immer. Bei beiden Filmen war es kein Thema, witzig sein zu
wollen. Aber vielleicht hat „Zugvögel“ etwas mehr Leichtigkeit.
Herrschte bei
dem Dreh von „Playa del Futuro“ eine andere Atmosphäre
als bei „Zugvögel“?
Ja. Die Atmosphäre bei „Zugvögel“ war zwar auch
nicht einfach, weil es etwa kein Geld gab. Aber bei „Playa del
Futuro“ gab es mehr Probleme.
Spüren
Sie denn auch eine andere Atmosphäre, wenn Sie den Film anschauen?
Nein. Ich sehe vielleicht Dinge, die man hätte anders machen können.
Aber ich finde den Film toll.
Schließlich
blieb auch der Erfolg aus.
Die Premieren liefen alle gut, aber wenn ihn dann am Ende nur 20000
sehen, ist das natürlich schrecklich. Immerhin hatten wir 2,5 Millionen
Produktionskosten.
Wenn es Ihnen
um das geht, was Sie im Herzen tragen, ist es doch eigentlich nicht
so wichtig, wenn den Film nicht so viele Menschen sehen? Geht es dann
nicht um den einzelnen, den man wirklich berührt?
Ja. Es geht um den einzelnen. Und nein, denn ich mache die Filme nicht
für mich. Bei einem Kinofilm sind 20000 Leute zu wenig. Zu sagen,
ich mache den Film für mich, ist nicht die richtige Einstellung.
Der ganze Prozess ist gut für mich, aber das fertige Produkt ist
nicht für mich. Ich mache das für die Leute. Ich will das
es ihnen danach gut geht und das sie etwas mit rausnehmen.
Also der eine
Begeisterte, den Sie vielleicht tief berührt haben, reicht Ihnen
nicht?
Ich hatte inhaltliche Gespräche mit Leuten, die sehr beeindruckt
waren. Es ist vielleicht weniger als bei „Zugvögel“.
Das, was in mir war, kommt beim Zuschauer wohl nicht so an.
Sind Sie ein
romantischer Träumer?
Ein Träumer bin ich, aber romantisch? Das ist schwer, selbst einzuschätzen.
Dafür bin ich eigentlich zu rational.
Aber Ihre Filme
sind doch sehr romantisch. Hauptantrieb der Menschen ist immer die Liebe.
Weil die jeder sucht. Ich will es mal so umschreiben und komme zu dem
zurück, was ich am Anfang gesagt habe: Man kann das Glück
nur in sich finden. Wenn ein Mann selbst unzufrieden ist, kann eine
Frau ihm auch nicht helfen. Der Charakter von Peter Lohmeyer in „Playa“
ist seit 15 Jahren unzufrieden, aber er ändert nichts. Deswegen
verschwendet er seine Zeit. Darum geht es. Der Mann ist an einem Ort,
wo er eigentlich nicht sein will. Er macht aber nichts, um da wegzukommen.
Auf die meisten Dinge, die einem gut tun, kommt man nicht, wenn es einem
einer sagt. Da muss man selbst drauf kommen. Du musst wach bleiben im
Leben. Aber zurück: Das Wort „Romantik“ benutze ich
einfach nicht.
Der Sonnenaufgang
am Ende von „Playa“ ist doch fast schon ein Klischeebild
für Romantik.
Klischee? Ist nicht ein echter Sonnenaufgang was ganz tolles? Ich finde
schon. Und: warum sehen wir die beiden Glücklichen von hinten?
Wir sehen sie von hinten und die Kamera fährt weg. Weg von dem
Ort, an dem sie sich drei Tage aufgehalten haben. Mein Gedanke war,
dass es nicht um die beiden geht, sondern um den, der das sieht. Die
beiden sind glücklich. Aber was ist morgen? Passen die überhaupt
zusammen?
Am Ende von
„Zugvögel“ bleibt ein ganz anderes Gefühl zurück.
Ein wilder Kuss, ein Kameraflug und elegischer Gesang. Alles ist feierlich,
transzendent, intensiv.
Eigentlich sind die Enden beider Filme ähnlich. Was du als Zuschauer
damit machst, ist das Entscheidende. Du kannst nur versuchen, gute und
glaubhafte Personen und Geschichten zu erzählen. Am Ende liegt
es am Zuschauer, ob er eine Transzendenz sieht und ein anderes intensives
Gefühl hat, oder einfach nur denkt, das ist aber kitschig. Das
ist ein schmaler Grat.
Ihre Filme
haben immer einen sehr melancholischen Charakter, enden aber im Glück.
Hat das etwas mit Ihrer Grundhaltung zu tun?
Das hat sicherlich auch mit meiner buddhistischen Sichtweise zu tun.
Es vollzieht sich langsam, ich kann Dinge klarer sehen und formulieren.
Sie wissen
jetzt mehr, was Sie im Leben wollen?
Ich weiß vor allem, dass man die Dinge nicht zu Ernst nehmen soll.
Ich könnte in eine tiefe Depression fallen, weil ich einen Film
gemacht habe, der gefloppt ist. Aber das hilft weder mir noch dem Film.
Wie sieht es
mit neuen Projekten aus?
Ich schreibe gerade ein fremdes Drehbuch um. Deswegen wird es den nächsten
Film etwas schneller geben. Und weil es von einem anderen Autor ist,
wird das auch etwas ganz anderes als „Zugvögel“ und
„Playa“. Und es gibt noch ein zweites Projekt...
Jetzt legen
Sie richtig los?
Ja, nach diesem Megaerfolg.
Und das zweite
Projekt ...
... wird etwas größeres und teureres. Eine Literaturverfilmung,
die schon lange in meinem Kopf herumschwirrt. Aber dazu kann ich noch
nicht mehr sagen, da wir die Rechte noch nicht besitzen.
Zum Schluss
noch zu etwas ganz anderem. In einem Interview habe ich gelesen, Sie
möchten in Spanien nach den Spuren Ihrer Vergangenheit suchen.
Was hat es damit auf sich?
Das war nicht ganz Ernst gemeint. Aber das ist trotzdem eine Frage,
auf die ich drei Stunden antworten könnte. Ich denke, das wir mehr
als ein Leben haben. Und ich bin mir eben sicher, dass ich mal Spanier
war. Denn es gibt ein Thema, bei dem ich ganz besonders emotional reagiere.
Die spanische Inquisition, bei der die Christen jeden umgebracht haben,
der nicht „Ja“ zu Gott gesagt hat. Das ist hunderte von
Jahren her, aber da werde ich so aufgewühlt.
Aber ich habe zu Spanien, wie auch zu Finnland, unabhängig davon
eine besondere Nähe. Wenn ich die Reise nach Spanien irgendwann
mal hinbekomme, würde ich mit dem Auto von A nach Z fahren, alleine
sein, meditieren, lesen und abends essen. Vielleicht auch mal einsam
fühlen. Ich hatte diesen Gedanken schon ganz vergessen. Schön,
dass Sie mich daran erinnern.
Vielen Dank
für das Gespräch.

|
In
Auszügen in "Cast - Das Schauspielermagazin",
Ausgabe 6/2005 erschienen.
"Cast"
im Internet:
www.schauspieler-magazin.de

|