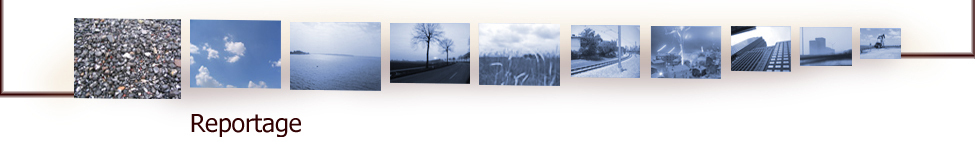Einfach gehen Wenn es in der Wohnung und im Kopf zu eng wird, muss man einfach mal raus. Gehen kann da befreien. Ein Experiment hat mich zu Fuß von Berlin aus in die brandenburgische Provinz geführt. Von der pumpenden Hauptstadt ins Karge. Ein Tatsachenbericht. Stadt. Zweieinhalb Stunden geradeaus. Vom Alexanderplatz bis zur S-Bahnstation Heerstraße. Man muss raus aus dieser Stadt. Am Brandenburger Tor viel Auflauf. Ein neuer Bundespräsident wird gewählt. Köhler oder Schwan stehen zur Wahl. Aber das Ergebnis interessiert hier niemanden. Berlin pumpt auch ohne Herz weiter. Man geht über geschichtsschwangere Straßen, die auch nicht mehr als Asphalt sind, und isst Eier. Zwei Stück, scheiß Regen. Man, was für ein scheiß Regen. Jetzt sind die Häuser hier schon so hoch und sie halten den Regen trotzdem nicht auf. Plakate von Sex-Messen und Monty Roberts, dem Pferdeflüsterer. Locker bleiben und raus hier. Man geht dann einfach so, spricht nicht und plötzlich spricht da jemand. Schon komisch. Eine Regenhose leistet gute Dienste. Scheiß Regen. Zuerst lief das Wasser über die Hose direkt in die Schuhe. Jetzt perlt es auf die Straße. Wenn die Füße anfangen zu brennen, setzt man sich einfach hin. Guckt und wartet. Mal innehalten, mal die Seele baumeln lassen, mal auf die inneren Stimmen hören, dem inneren Jemand lauschen, mal das Leben Revue passieren lassen. Irgendwann hat dann alles Geradeaus mal ein Ende und es geht um die Ecke. Die Sonne bricht durch dunkelblaugrauschwarze Wolken. Um den Wolken näher zu sein, rauf auf den Teufelsberg. „Was für eine Aussicht“, steht auf einer Postkarte, die in einer kleinen Seitenstraße, in einem Kiosk, in einem weißen Drahtständer steckt. Ein Euro. Die Luft ist diesig, das Blicklicht des Fernsehturmes in der Ferne. Würde man dort losgehen und bis hierher laufen, sieht das nach einem langen Weg aus. Berlin ist groß. Wenn man vom Land kommt, könnte das hier wirklich eine Großstadt sein. Woltwiesche: Ein Dorf in der Mitte Niedersachsens mit 2000 Einwohnern und einer 850jährigen Geschichte. Es gibt einen Bahnhof, eine Volksbank, zwei Bäcker, zwei kleine Einkaufsläden, eine Grundschule und die Gemeinschaft „Unser Dorf soll schöner werden“. Vor vielen Jahren geschah einmal ein Mord. Auf dem Teufelsberg. Auf der einen Seite der Alexanderplatz, auf der anderen drei Abhörkugeln. Man könnte jetzt darüber nachdenken, was die für eine Aufgabe hatten, muss man aber auch nicht. Wirklich nicht. Das kann man einfach so hinnehmen. Wir sind doch nicht im Kalten Krieg. Die schöne Aussicht muss ein Ende haben. Über eine halbvermoderte Treppe hinunter. Runter vom Teufel. Und irgendwann muss der irgendwohin kacken. Rein in den Busch. Stadt/Erschöpfung. Raus aus dem Busch, raus aus dem Wald. An der Avus (die, Abk. für Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße, ehem. Automobilrennstrecke in Berlin, zw. Grunewald und Nikolassee; 9,8 km lang; 1921 fertig gestellt; Prototyp der Autobahnen). Eine Frau zeigt den Weg. Sie fährt mit ihrem Fahrrad weg. Etwas zu schnell. Hätte man einen elf Kilo schweren Rucksack, wäre es schwierig ihr zu folgen. Kurz vorher hat es gehagelt. Die Frau trägt schwarze Pumps. Rock oder Hose sind unter der Regenjacke verdeckt. Wahrscheinlich Rock. Ihr blaues Make-up ist ein bisschen verwischt und auf ihrem Gepäckträger quellen einige Plastiktüten aus einer braunen Ledertasche. Man könnte denken, sie haut ab. Man könnte denken, sie hat Angst vor Menschen, die sie nach dem Weg fragen. Dreihundert Meter später wartet sie an der Karte und erklärt. Man geht weiter als sei nichts gewesen. Man denkt über das Leben dieser Frau nach, als hätte man kein eigenes. Ute K. wohnt in der Schopenhauerstraße und hat vor vier Wochen ihren Sohn Klaus K. auf dem Waldfriedhof Zehlendorf beerdigt. Was für ein Tod. Als die Nacht am Tiefsten war und der Vollmond gerade hinter einer Wolke verschwand, kletterte Klaus K. über den Maschendrahtzaun am Rand der Avus, näherte sich langsam der Fahrbahn und warf sich vor einen BMW 520i. Einen Kilometer später hätte man ihn mit Tempo 150 geblitzt. Klaus K. war sofort tot, der Mond kam hinter den Wolken zum Vorschein, und seine Mutter sagt etwa im gleichen Moment zu ihrem Mann, dass sie jetzt nicht mit ihm schlafen will. Der Fahrer des BMW 520i, Hans D., ist in dieser Nacht auch auf der Flucht. Er wurde in der Berliner Wohnung seiner Freundin, Karen Z., von deren Ehemann, Markus Z., erwischt. Als Klaus K. auf die Straße springt, vor den Wagen von Hans D., wechselt dieser gerade das Taschentuch, mit dem er immer wieder das Blut von seiner Nase abwischt. Markus Z. hatte für Ordnung in seiner Wohnung gesorgt. Stadt/Leere. Schenkelstrecker, Schienbeinmuskel, Schneidermuskel, Zwillingswadenmuskel, Schollenmuskel, zweiköpfiger Oberschenkelmuskel. Gewebe in den Beinen, das irgendwann nicht mehr arbeiten will. Man geht einfach weiter und denkt an nichts anderes mehr außer Schokoriegel. Ein Gedanke, volle Konzentration. Zucker, Zucker, Zucker. Aber ein Gedanke zählt nicht. Wer nur an eine Sache denkt, denkt nicht. Neben der Straße auf der einen Seite Wald, auf der anderen die Avus. Die Füße würden brennen, wenn sie könnten. Vom Asphaltweg ab in den Wald. Ein rutschiger Ast bringt den Sturz. Unabgestützt knallt man auf die Seite und es ist egal. Trance. Einfach weiter gehen. Wurmlocher sind Verformungen, in denen Zeit und Raum nicht mehr existieren. Und wenn sie doch existieren, werden sie gebogen, gedehnt, gestreckt. Beim Gehen ist es ähnlich. Nur sind hier die Biegungen des Raumes zu sehen, aber dahinter kommt dann trotzdem nichts Neues. Und die Zeit hat am Standrand aufgehört. Wenn man jetzt die Schuhe auszieht, wären dann da noch Füße? Man müsste jemanden fragen. Ständig kommen auf diesem Weg irgendwelche Menschen an einem vorbei. Ob denn einer mal was zu essen hat. Zucker pur wäre auch gut. Aber man bleibt so für sich. Man kann nicht mehr reden und will es nicht mehr. Macht man doch den Mund wieder auf und da kommen dann Worte raus, dreht man sich um und hin und her und niemand ist da. Hinsetzen und nicht mehr aufstehen können wollen. Wollen und nicht können. Und schon gar nicht können. Auf der Avus fährt ein Lastwagen mit Nestleaufschrift vorbei. Jetzt eine Explosion und Schokoregen. Oder ein Wurmloch mitten auf der Straße. Der Wagen fällt rein, man klettert über den Maschendrahtzaun, bricht die Türen auf und isst. Man geht einfach weiter und lauscht auf den dunkler werdenden Tag. Provinz. Auf einem Steg am Wannsee. Zwei Frauen machen gerade eine Jolle klar. Das Wasser spült an den Strand. Wind kommt auf. Das Segel flattert. Auch wenn die beiden noch Tage bräuchten, bevor sie in See stechen, würde man sich nicht trauen, sie zu fragen, ob man mit darf. Eine geht vorbei und lächelt. Dann ist man verliebt und kann noch weniger fragen. Jetzt rausfahren und lieben. Den ganzen Tag. Vielleicht kennen die beiden „Funny Games“. Das letzte Opfer stirbt auf einem See. Mit zusammengebundenen Füßen und Händen wird eine Frau von einer kleinen Jolle in einen See geworfen. Einfach so. Nebenan liegen in einer kleinen Hafenanlage noch weitere Segelboote. Ihre kahlen Masten schlagen aneinander. Man steht auf und geht. Man muss ja weiter. Nur noch über die Brücke und Potsdam beginnt. Einige Schwalben attackieren eine Nebelkrähe ohne erkennbaren Grund. Die Krähe sitzt auf einem Poller, einer Anlegemöglichkeit etwas ab vom Steg, und die Schwalben kommen immer wieder im Sturzflug auf sie zu. Die Krähe duckt sich wie ein Boxer und tänzelt. Im Westen sind die Krähen ausschließlich schwarz und heißen Rabenkrähen. Im Osten haben sie einen weißen Schal, und man nennt sie Nebelkrähen. Gleich wird es regnen. Potsdam ist Sanssouci und ein Park. Alte Gemäuer, gepflegte Wege und gepflegte Menschen auf Postkartensammelfahrt. Man selber ist zu. Geschlossen. „Es tut uns Leid, aber dieser Mensch ist gerade außer Betrieb. Bitte kommen Sie später wieder.“ Nur im Freundschaftstempel hält man kurz inne und denkt nach über nichts und wieder nichts. Provinz/Erschöpfung. Trotz Vorsorge bricht das System wieder zusammen. Snickers und Lion werden sofort rückstandslos verbrannt und tauchen nie wieder in den Büchern auf. Hier wurde doch Schindluder getrieben. Vollkommen irreale Zahlenkolonnen, Leistungskurven und Emotionen, und niemand merkt das. Jetzt mal langsam darüber nachdenken, wie es überhaupt bis zu diesem Punkt kommen konnte. Langsam alles aufrollen, kontrollieren und überprüfen. Die Verantwortung hat man selber zu tragen. Mit Gedanken stolpert man aus dem Schlosspark hinaus und ab in den Wildpark im Südwesten. Da wird man zu sich kommen. Mal innehalten, mal die Seele baumeln lassen, mal auf die inneren Stimmen hören, dem inneren Jemand lauschen, mal das Leben Revue passieren lassen. Am Waldrand ein Tierheim. Die Hunde kläffen. Ganz laut. Im Wald versteht man dann die Welt nicht mehr vor lauter Stille. Und Science Fiction. Man pinkelt an den Wegrand und eine Mücke kommt und will einen. Immer, wenn man stehen bleiben will, sind sie wieder da. Die Beine voller Mücken. Sie sind überall. Wegscheuchen bringt hier gar nichts. Es sind zu viele. Man geht weiter, es muss ja weitergehen. Auch wenn man jetzt eigentlich stehen will. Stehen, ruhen, warten, nichts tun. Für einen Lidschlag. Man geht etwas schneller als vorher, Mücken sind langsam. Die muss man doch abschütteln können? Irgendwann ein neuer Versuch. Man bleibt stehen und sie sind noch da. Keine Angst, aber ein bisschen Lust auf Panik. Auf einer kleinen Lichtung tötet man alle. Man kann nicht mehr weglaufen oder sich kampflos stechen lassen. Für einen Moment ist Ruhe. Dann kommen langsam die ersten zurück. Schlag! Und tot. Wieder kommen sie in einem ganzen Schwarm, ihr Ziel Rache. Provinz/Leere. Der Wald ist zu Ende, man selber auch. Nach den Mücken kommen zwei von der Bank. Sie fragen, wo es zur Sparkassentagung geht. Man hat gerade mit Mücken gekämpft, man trägt einen elf Kilo schweren Rucksack, man sammelt Blasen an den Füßen und Dreck auf der Kleidung. Und das alles nur, um zur Sparkassentagung zu kommen? Die beiden bleiben stehen und fangen an, zu diskutieren. Der Weißhaarige, Ältere, will umdrehen. Er glaubt, sie gehen in die falsche Richtung. Der junge Brillenträger will in dieser Richtung weiter. Dann hört man sie nicht mehr. Sie holen Karten raus. Dann die Havel. Man würde sich gerne reinschmeißen. Außer einer Eisenbahnbrücke ist nichts zu sehen. Umwege sind ausgeschlossen. Man will da rüber. Man fragt sich durch und findet den Weg über die Brücke. Auf der anderen Seite geht es einen schmalen Weg entlang. Der Blick fällt auf ein „Vivil“-Papier. „sans sucre“ steht da. Sans Souci, sans sucre. Souci sucre. Jetzt locker bleiben. Plötzlich steht man auf einer Straße. Und nichts ist da. Keine Gefahr, kein Geräusch, kein Getier. Man steht da, gerade zwischen Sträuchern durchgekämpft, und schaut immer wieder zur einen Seite, dann wieder zur anderen Seite. Nichts passiert. Kein Auto, kein Arsch, keine Ameise. Der Wind bewegt noch die Äste, und man selber atmet noch. Man geht weiter, weil es sein muss und sein soll. Flaches Land. Die B2. Nur die Beine sind noch da. Nichts ist außerhalb der Straße zu sehen. Das muss sich ändern. Man kann nicht mehr auf diesem verdammten Asphalt laufen. Man schlägt sich in den angrenzenden Wald. Weicherer Boden, weniger Autos. Man versucht parallel zur Straße zu laufen. Nach einigen hundert Metern ist klar, man hat sich verirrt. Eine ältere Dame und ein kleiner Hund zeigen den Weg. Durch Nadelhölzer, weicher Nadelboden, sandig. Ein Maschendrahtzaun. Egal, rüber. Es gibt kein Zurück mehr. Umwege sind nicht möglich. Man steht auf einem Schuttabladehof. Gerade ist niemand hier. Ein Fahrrad steht angelehnt an einer Wand, nicht abgeschlossen. Aus einem kleinen Schornstein steigt dünner Rauch, es ist nicht kalt. Wieder auf dem Gehweg an der B2. Gegen alle Vernunft schlägt man sich ein zweites Mal auf der anderen Seite in den Wald. Auf einem Reiterpfad entlang. Sofort wieder verirrt. Es kommt ein Mann: Schwarze Stofftasche und ein Vogelkundebuch in der Jacke. Spricht man von Beelitz und der B2, werden seine Augen hinter der Brille ganz klein. Er sagt: „Falsche Richtung!“ Er sagt es so, als würde es mindestens das Schicksal der gesamten Menschheit bedeuten. Umdrehen? Ausgeschlossen! Dann eben querfeldein. Einen Abhang runter, über Schienen, einen Abhang hoch. Über Wege mit riesigen Reifenspuren. Oder Ketten? Krieg? Wieder Maschendrahtzaun und kein Weg. Geräusche, dann endlich die Straße. Flaches Land/Erschöpfung. Die Grenze ist überschritten. Von den Füßen aufwärts schmerzt alles. Darunter auch. Die Talking Heads singen Road To Nowhere. Die B2 fräßt sich durch Brandenburg wie eine Säge, die den Brustkorb auftrennt. Am Straßenrand liegt ein Greifvogel. Eine Kralle in die Luft gereckt. Dann eine Katze. Ein Reh rennt am Rand durch den Wald. Will zur Straße, will sich zermatschen lassen. Man selber steht da, fuchtelt mit den Armen und in einem Auto sagt Markus Z. zu Karen Z.: „Schau mal diesen Idioten an. Der wollte wohl Lotse werden.“ Ein schwarzer Golf fährt an einem vorbei, man schaut auf die Insassen. Das Reh wechselt die Richtung und läuft weg. Nirgendwo Fußgänger, nur ein Typ steht da und sagt: „Hat Dich ein Elefant in den Arsch gefickt?“ Man spricht nicht, denkt nicht. Überall Spargelfelder. Alles richtet sich darauf, einen Punkt zu finden, bei dem Bewegung nicht schmerzt. Hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, nicht aufstehen können. Es zieht, zerrt, zuckelt und ruckelt im Körper. Da will was nicht mehr. Aber man muss weitergehen, weil man es will. Dann legt man sich doch in ein Bushaltestellenhäuschen und bleibt. Flaches Land/Leere. Seddin. Sediert. Man will weiter und liegt einfach nur da. Man schließt die Augen und hört zu. Mal innehalten, mal die Seele baumeln lassen, mal auf die inneren Stimmen hören, dem inneren Jemand lauschen, mal das Leben Revue passieren lassen. Über einem ein feingesponnenes Netz. Darin eine zuckende Fliege. Noch sind ihre Flügel nicht zusammengebunden. Sie surrt. In einer Ecke hat die Spinne ihr Nest. Ganz langsam kommt sie herausgelaufen und nähert sich der Fliege. Dann geht es schnell, nichts surrt mehr und die Spinne verschwindet wieder im Nest. Noch ist nicht die Zeit, um zu essen. Man dreht den Kopf zur Seite und schaut auf die Straße. Die Autos fallen von oben nach unten. Im Liegen sind die Schmerzen in Watte gepackt. Für den Versand verstaut. Aus dem Augenwinkel sieht man, wie im Westen dunkle Wolken aufziehen. Stetig wandern sie auf einen zu. Direkt über einem fliegen noch die hingehuschten Cirrocumulus. Die Dunkelheit kommt näher. Die Autos haben die Scheinwerfer angestellt und flügen sich durch den Regen. Das Bushaltestellenhäuschen ist gerade soweit von der Straße entfernt, dass der aufspritzende Regen einen nicht erreicht. Der Regen fällt lange. So lange bis er aufhört. Als er aufhört, steht man auf, geht zur Straße, ein Auto hält an und man steigt ein. Eine Autofahrt. Zehn Kilometer pro Stunde. Langsam fährt der Wagen los, man selber lässt los, lässt sich sanft in den Sitz drücken und schaut aus dem Fenster. Zwanzig Kilometer pro Stunde. Die Wolken brechen auf und die Sonne scheint. Wieder Spargelfelder. Beelitzer Spargel. Am Straßenrand die grauen Busse der Gastarbeiter, leere Plastikkisten und Europaletten. Dreißig Kilometer pro Stunde. Ein Vogel segelt im Tiefflug über die mit Planen abgedeckten Beete. Niemand ist zu sehen. Ein paar Dixiklos stehen herum. Vierzig Kilometer pro Stunde. Durch Dörfer mit grau verputzten Fassaden, von denen einiges abbröckelt. Darunter rote Steine. Fünfzig Kilometer pro Stunde. Schienen. Etwas abseits ein Silo und daneben eine Halle. Kein Zug. Sechzig Kilometer pro Stunde. Strommasten aus Holz. Das Kabel hängt etwas zu stark durch. Ganz am Rand, in der Nähe eines Mastes sitzt eine Taube. Als der Wagen an ihr vorbeifährt, fliegt sie weg und kackt. Siebzig Kilometer pro Stunde. Abseits ein Radweg. Ein älterer Mann auf einem Fahrrad. Vorne ein Korb, hinten ein Korb. Beide sind mit roten Penny-Plastiktüten vollgepackt. Er schnauft. Achtzig Kilometer pro Stunde. Die Landstraße dehnt sich immer weiter. An den Seiten laufen die Felder bis zu einem Horizont. Neunzig Kilometer pro Stunde. Schaut man raus und sieht wie sich die Landschaft bewegt, spürt man nicht mehr, dass man sich selber gar nicht bewegt. Alles ist in Bewegung. Es geht immer weiter. Einhundert Kilometer pro Stunde. Ungebremst fährt der Wagen mitten hinein.
|
Fotos: Tim Meyer Dieser
Text erschien in abgeänderter Form in der
|