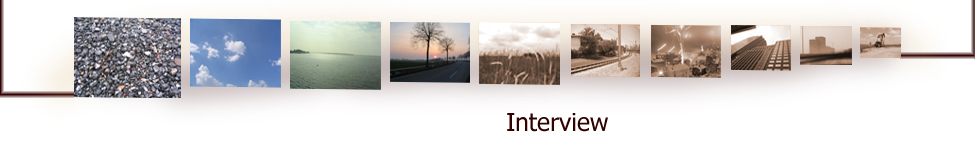Den Kapitalismus Simon Solberg über sein Theaterprojekt Pimp The City, Radikalität und warum die Altlinken eigentlich bis zum Ende ihres Lebens ihren Idealen treu bleiben müssten. Erzählen Sie doch bitte kurz, wie Sie von dem Projekt Making of The Band – das von vier Musikern handelte, die berühmt werden wollten, um die Stadt zu verändern – zu Pimp The City – einer Zusammenarbeit mit Hartz-IV-Empfängern – kamen. Making of The Band war als Partyformat gedacht und als etwas, dass in die Stadt geht. Es sollte mit den Menschen Mannheims zu tun haben. Ich habe ganz viel mit Video gearbeitet. Dabei kam es bereits zu einer Zusammenarbeit mit Hartz-IV-Empfängern. Im Anschluss an Making of The Band wollten wir dann ohne den Bandquatsch als Rahmen, finanzielle Möglichkeiten über die ARGE Job Center Mannheim und die Kulturstiftung des Bundes schaffen, um uns ausschließlich mit Langzeitarbeitslosen beschäftigen zu können. Es ging uns darum, den Starkult umzudenken und in Menschen zu investieren, die eigentlich am gesellschaftlichen Rand stehen. Durchaus. Ich mache Theater, weil mich gesellschaftliche Prozesse interessieren. Wann, wo, wie und vor allem warum etwas falsch läuft. Es ist für mich viel spannender, sich mit den Lebensumständen einer handelnden Person und ihrer Sozialisierung auseinanderzusetzen, als nur zu inszenieren, warum sich zwei Figuren ineinander verlieben. Glauben Sie, dass Theater etwas verändern kann? Unterm Strich schon. Wenn man es nicht nur darauf beschränkt, was auf der Bühne passiert. Das Theaterpublikum gehört sowieso schon eher zu dem aufgeklärteren Teil der Bevölkerung. Meine Chance und Aufgabe als junger Regisseur sehe ich darin, gewisse erziehungsbedingte Gedankenstrukturen zu hinterfragen, anzugreifen oder sogar zu zerstören. Es geht mir darum, zu provozieren und Alternativen aufzuwerfen. Und gerade dabei hat Theater eine große Chance, weil es ehrlich ist. Man trifft sich an einem Abend, um etwas zu erzählen und etwas erzählt zu bekommen. Der Schauspieler ist da, er schwitzt, er stinkt, er spuckt und er spielt. Durch diese Verabredung kann er sich als Figur Sachen erlauben, die man sich selbst im normalen Leben nie trauen würde. Bei Pimp The City war es uns wichtiger, ein ungewöhnliches Publikum an ungewöhnlichen Orten zu treffen, als dass sich das Projekt im materiellen Sinne rentiert. Wenn Sie das sagen, stellt sich die Frage, ob das Projekt trotzdem als Kunstprodukt für Sie wichtig war oder ob es sich eher um soziales Engagement mit Kunstcharakter handelt? Tja, soziales Engagement ist natürlich schon ein ziemlich großes Wort. Ob es sich am Ende um Kunst handelt, muss ich glücklicherweise nicht entscheiden. Pimp The City war eine Gradwanderung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Bei den Vorgesprächen lernten Sie die Teilnehmer in einer eher privaten Situation kennen und mussten dann entscheiden, was Sie davon dem Publikum präsentieren können, ohne den Menschen bloßzustellen. Wie sind Sie damit umgegangen? Um die Situation umgehen zu können, dass ungeübte Darsteller jeden Abend ihre ganz private Lebensgeschichte live auf der Bühne erzählen müssen, haben wir viel dokumentarisch gearbeitet und mit einer Kamera die Gespräche mitgeschnitten. Die Teilnehmer konnten dann entscheiden, welche intimen Momente in die Show kommen. So etwas macht mich unglaublich aggressiv. Ich würde dem Mann antworten: „Es geht um eine künstlerische Beschäftigung von Hartz-IV-Empfängern, die im besten Fall zur Folge hat, dass sie mit Ihnen über soziale Arbeit reden, wenn Sie gerade NTV gucken.“ Wenn bei ihm von dem Abend nur hängenblieb, wie hoch der Hartz-IV-Regelsatz ist, dann tut es mir für ihn leid. Und für uns eigentlich auch, denn dann scheinen wir nicht das Funkeln in den Augen der Teilnehmer rübergebracht zu haben. Der Auftrag von der ARGE Job Center Mannheim und der Kulturstiftung des Bundes war, sich mit der Stadt zu vernetzen und mit den Menschen an ihrer persönlichen Situation zu arbeiten. Ich finde, es ist komplett Kunst und keine Sozialarbeit. Wenn man an die Umsetzung von persönlichen Träumen raus aus einem Arbeitslosengeld-II-Alltag geht und sich damit öffentlich zur Disposition stellt, wird es in meinen Augen zu Kunst. Wenn wir die Lebensgeschichten erzählen und schildern, an welchen Punkt wir auf der Suche nach Alternativen gemeinsam gekommen sind, wird es zu Kunst. War die Zusammenarbeit immer einfach? Es gab Momente, in denen es oft nur noch um eine menschliche Auseinandersetzung ging. Es gibt bei jedem einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Manchmal kann man sich dann auch vorstellen, warum sie in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind. Einiges liegt einfach im Argen. Um daran zu arbeiten, sind acht Wochen wirklich zu kurz. Stoßen Sie als Theaterregisseur dabei an Ihre Grenzen? Ja. Weil man Prozesse erreicht, die nichts mit einer Theaterverabredung zu tun haben, sondern mit Schicksalen, Problemen und Entscheidungen. Aber ist das nicht der Punkt, an dem man ein solches Kunstprojekt doch gemeinsam mit einem Sozialarbeiter machen müsste? Bestimmt. Doch die Frage ist, ob der normale 0815-Sozialarbeiter damit zurechtkommen würde. Sind Sie denn mit den Ergebnissen von Pimp The City zufrieden? Die Frage stellt sich für mich nicht. Wir haben alles gegeben und gemeinsam zeigen wir die Stationen unserer Suche. Ich kann nicht zufrieden sein. Das wäre ich vielleicht, wenn alle einen Job hätten. Aber auch wenn wir nicht alles geschafft haben, konnten wir doch das Selbstbewusstsein bei jedem pimpen. Die Kollegen gehen raus und haben Lust, den Auftritt zu rocken. Sie wollen die Zuschauer daran teilhaben lassen, wie sie sich aktiv mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzen. Alles andere ist mir eigentlich wurscht, wenn wir das erreicht haben. Werden Sie das Leben der Teilnehmer nach dem Projekt verfolgen? Wir wollen uns einmal pro Woche treffen und schauen, wie es aussieht. Natürlich geht die Mühle für mich weiter und man ist in der nächsten Produktion. Und die Gefahr besteht doch, dass die Teilnehmer nach dem Projekt in eine Leere fallen. Im sogenannten Premierenloch werden wir uns wohl alle wiederfinden. Das ist selbst bei professionellen Schauspielern so. Aber die Schauspieler wissen, dass die nächste Produktion kommen wird. Das stimmt bedingt. Aber soll man mit dem Wissen, dass eine Leere danach nicht ausbleiben wird, dieses Projekt gar nicht erst machen? Es ist wichtig, dass wir uns nach den Vorstellungen weiter treffen. Die Energien, die die Teilnehmer im Projekt entwickelten, haben sie selbst aufgeworfen. Das müssen sie verstehen. Die Grundschwierigkeit einen Job zu bekommen, ändert sich durch das Projekt natürlich nicht. Aber es öffnet einen neuen Horizont. Ich finde, unterm Strich ist es viel wichtiger, die Möglichkeiten zu haben, sich selbst ein Umfeld zu schaffen, in dem man selbst wichtig ist und Freunde hat. Diese Job-Nummer ist etwas, was unsere Gesellschaft generiert hat. Der Mensch braucht das in meinen Augen nicht. Der Mensch braucht eine Aufgabe und Selbstbestätigung. Beides bekommt er aber nicht unbedingt durch Lohnarbeit. Würden Sie gerne radikaler arbeiten? Ich versuche, mich von Projekt zu Projekt zu radikalisieren und weiter zu positionieren. Ich träume davon, über Kunst Denkprozesse anzustoßen und Dinge zu verändern. Das ist meine Utopie. Sonst würde ich die Arbeit nicht machen. Mein größtes Problem ist das Mittelmaß in Deutschland. Wollen Sie die Gesellschaft langsam mit Projekten wie Pimp The City umgestalten? Oder ist die Revolution mit Gewalt für Sie die richtige Lösung? Wenn ich den Mut hätte, würde ich vielleicht radikaler arbeiten. Zum Beispiel reizt es mich in unregelmäßigen Abständen, die Türme der Deutschen Bank in die Luft zu sprengen. Wäre aber zum einen Ideen-Raub und zum anderen steht es mir nicht zu, über das Leben eines anderen zu richten. Bleibt also nur die Flucht in die Kunst. Von dort aus kann man zwar nur bedingt schießen oder sprengen, aber immer wieder unangenehm pieken. Vom Prinzip her finde ich den bewaffneten Widerstand total nachvollziehbar. Aber nur um Rechte zu sichern und nicht um Menschen zu bestrafen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die moralischen Werte komplett verlorengegangen sind und nur noch zählt, möglichst viel Geld anzuhäufen. Auf der anderen Seite hat man eine riesige träge Masse, die sich zwar verarscht vorkommt, aber nicht auf die Straße geht. Die Frage ist: Wo setzt man überhaupt an, wo radikalisiert man sich? Wie werden Sie mit diesen Gedanken bei Ihrer weiteren Arbeit umgehen? Es muss darum gehen, sich immer weiter aus dem Fenster zu lehnen. Utopien immer genauer zu spinnen, um irgendwann an einen Punkt zu kommen, an dem man positiven Druck ausüben und andere zum Mitmachen bewegen kann. Letztendlich braucht man die Masse. Man müsste zum Beispiel eine neue Art von Pop-Kultur schaffen mit Formaten wie: Pimp My Oma. Man müsste einen Hype generieren, dass alle Leute es plötzlich cool finden, nicht mehr ihrer Lohnarbeit nachzugehen, sondern zu Hause die Oma zu pflegen oder sich um die Kinder zu kümmern. Ich bin auch ein Verfechter des Bürgergeldes. Unsere Gesellschaft ist reich genug. Lohnarbeit ist doch wie die Sklavenarbeit im alten Ägypten. Wollen Sie den Kapitalismus abschaffen? Es geht darum, den Kapitalismus mit Kunst zu unterwandern. Ich glaube nicht, dass man ihn abschaffen kann. Er ist der menschlichen Struktur zu ähnlich. Man will jagen, besitzen. Es gibt aber genug Leute, die etwas verändern wollen. Sie müssen sich nur richtig vernetzen. Ich warte täglich darauf, in den Probenarbeit auf die richtige Idee zu stoßen. Eine Idee, die wirklich etwas bewegen kann. Gibt es für das radikale Denken eine Initialzündung? Nein. Ich bin schon immer durchgedreht, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde ungerecht behandelt. Wie kann man den Idealismus, den Glauben an die Veränderung in der Gesellschaft konservieren? Das Problem jeder Revolution ist doch, dass man immer nur in seiner eigenen kleinen Bahn denkt. Die Altlinken müssten eigentlich bis zum Schluss durchackern, damit das Gedankengut an ihrem Lebensende in die nächste Generation überschwappen und weitergedacht werden kann. Wird man nicht zwangsläufig im Leben des Kampfes müde, weil man feststellt: Die Prozesse, die man anstößt, kommen nicht voran. Ich glaube, der Trick könnte sein, seinen Kampf oder seine Arbeit mit so viel Quatsch, Spaß und Unfug zu kombinieren, damit man nie die Lust daran verliert. Sagt sich super mit 27.
|
Simon Solberg arbeitet mit Norbert Leklou an seinem Text
Videoaufnahmen für Pimp The City im Regenauffangbecken der Stadtentwässerung Ludwigshafen
Simon Solberg als Polizist in Pimp The City
Das Büro
Fotos: Tim Meyer
Reportage Für einen neuen Arbeitsbegriff |