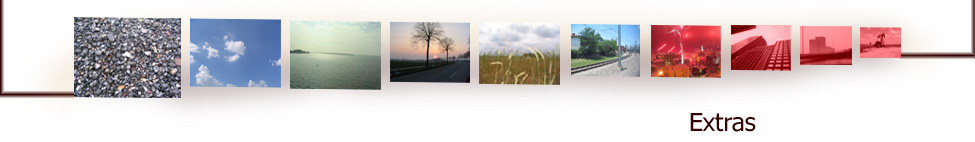Lost In Space
Manchmal liege ich im Bett und fliege einfach fort. Es ist nicht wie in einem Traum, in dem es reicht, kräftig mit den Armen zu rudern, um von der Erde abzuheben. Es ist ein Sog, der mich fortzieht. Als würde ich mich trotz aller Warnungen vor die Turbine eines startenden Jets stellen. Eingesaugt, zerwirbelt, pulverisiert. Ich spüre von alldem nur ein Ziehen im Bauch und sehe, wie ich im schwarzen Nichts des Universums an unbekannten Planeten vorbeifliege. So liege ich da und denke über das Ende nach. Den Tod. Das Nichts. Über das Nicht-mehr-denken-können, über das Nicht-mehr-fühlen-können, über den Schlaf, aus dem es kein Erwachen mehr gibt. Nie wieder. Bis in die Tiefen der Unendlichkeit. Ich habe Angst. Todesangst.
In diesen Momenten nehme ich mir vor, am nächsten Tag alles anders zu machen, mein Leben noch bewusster zu leben. Keine Kompromisse. Mehr Glücksgefühle, mehr Zufriedenheit. Volle Energie, volle Leidenschaft. Ich nehme mir vor, endlich unerledigte Sachen zu Ende zu bringen. Sport zu treiben. Nett zu sein. Meine Träume und Ziele zu verfolgen. Ich selbst zu sein. Aus den Mauern der Egozentrik auszubrechen. Einfach zu leben, solange ich noch lebe.
Oft ist der Tod, die Motivation am nächsten Tag vergessen und ich vergeude einen Tag. Weil mir wieder nicht bewusst ist, dass jeder Tag ein Teil des Weges ist. Dass mich jeder neue Tag dem Nichts, dem Ende von allem näher bringt. Ich brauche den Tod, um die wahre Schönheit des Lebens zu sehen. Die Gewissheit des Todes bringt mich dazu, jetzt, hier und heute zu leben. Nieder mit dem Aufschub, Schluss mit dem Warten. Ich will das Leben nutzen. Ich will Spuren hinterlassen. Auf der Welt, in mir, in anderen.
Im Sturm der Liebe für eine Stunde
15 Uhr, Pro Sieben, We are family:
Jörg ist Busfahrer. Seit sieben Jahren führt er mit Gabi eine fünfköpfige Patchwork-Family an. Sie sind fast richtig glücklich. Aber wenn es nichts zu sehen gebe, würde nicht das Kamerateam wie eine heiße Hündin durch die Wohnung schwänzeln.
Für Marina war die Umstellung besonders schwer. Bis sie zu ihrem fünften Lebensjahr hatte sie ihre Mutter für sich allein. Dann musste sie teilen und schnell entstand Neid. „Sie war eifersüchtig gewesen“, sagt Gabi. Heute ist aber alles besser. Wenn die zwölfjährige Marina doch bloß nicht so in Tokio Hotel vernarrt wäre. Und weil sie nach dem Verweis in Deutsch jetzt auch einen in Mathe mit nach Hause gebracht hat, werden die CDs konfisziert und das Handy kommt wieder unter Verschluss. Bevor die Kamera ganz nah an Marinas, verheultes Gesicht heranzoomt, schalte ich um.
15.10, ARD, Sturm der Liebe:
„Alexander, ich hab mich für dich entschieden. Das musst du mir glauben“, sagt Katharina mit zitternder Stimme. Aber Alexander ist sauer. Was ist da nur passiert? Die nächste Einstellung illustriert den Dialog: Gewitterwolken über einem Bergsee. Schnitt.
Neben einem weißen Pferd sitzt eine junge, schöne Frau im Rollstuhl. Neben ihr ein Mann, der sie auf ihre Examensarbeit in Botanik anspricht und ihr das Du anbietet, weil sie ja gemeinsam ausgeritten wären. Hoppla, jetzt hat er kurz ihre Behinderung thematisiert, dass tut ihm aber Leid. Schnitt, denn hier muss alles schnell gehen. Die große Kunst der Tragödien-Parallelität.
Helen hat einen Termin beim Psychiater. Sie will aber nicht hin. „Ein Arzt darf ein Verbrechen nicht decken. Das ganze Blut und der Tote. Ich kann das nicht erzählen“, sagt sie, ohne zu lachen. Ach quatsch, natürlich lacht sie nicht. Das ist keine Comedyshow, das ist das wahre Leben.
15.16, RTL, Das Familiengericht:
Es geht um Prostitution. Ich finde aber den Einstieg nicht. Um 15.19 Uhr beginnt die Werbung. Wie erleichternd es doch ist, dem Klopapierbären von Charmin kacken zu sehen. Und beim Hygienestaubsauger Dirt Devil stelle ich mir vor, den mit dem Fernseher zu verbinden und den ganzen Kram herauszusaugen. Aber das wäre zu einfach. Erstmal schauen, was da noch kommt.
15.21, Sat 1, Richterin Barbara Salesch:
Die rothaarige Kampfrichterin wird gerne laut und fast fällt ihre Brille von der Nasenspitze. Es geht um den angeblich in einer Putzfirma beschäftigten Öztürk. Der soll aber im großen Stil, äh, mafiös, Discos betreiben. Öztürk spricht in einwandfreiem Kanak Sprak. Darf man wenigstens hier in der Richtershow noch rassistisch sein? Die Laienspieler wechseln ihre Meinungen schneller, als eine nasse Badehose in brütender Hitze trocknen kann. Herrlich, überall wir gerichtet.
15.30, Kinderkanal, Löwenzahn:
Ein Igel frisst eine Ringelnatter. Dann zankt sich Peter Lustig wieder mit seinem Nachbarn. Diese späthippieske Unterhaltung wirkt beim Durchzappen wie aus der Zeit gefallen. Eigentlich ist sie wirklich aus der Zeit gefallen. Die Sendung ist von 1993. Da war ich fünfzehn. Um 15.45 Uhr wird Peter heute wieder sagen: „Und jetzt schaltet ihr bitte ab.“ Aber Abschalten gilt heute nicht. Ich muss weiterschauen.
15.41, ARD, Sturm der Liebe:
Ein voller Mond, ein nacktes Pärchen in Decken gemummelt auf dem Boden. Der Mann sagt: „Erzähl mir von dir und ihm. Ich möchte das verstehen.“ Er spielt also hier den Verständnisvollen. Sie erzählt, ihr Mann sei ihre Sandkastenliebe, sie wollten schon immer heiraten. Jetzt erkenne ich sie. Es ist Katharina, die vor einer halben Stunde Alexander ihre Liebe schwor. Ich bin ein bisschen entrüstet.
15.45, ZDF, Ruhrpott-Schnauzen – Geschichten aus dem Duisburger Zoo:
Hier fressen gerade die Zwergflusspferde Salat. Wie schön. Das ist Urlaub.
15.48, Pro Sieben, Werbung:
Ein Junge wischt seine Mutter mit einem Zewa-Tuch weg. Dann kommt Eigenwerbung des Senders, in der die drei Finalistinnen von Heidi Klums Modellsuche in knappen Bikinis tanzen und sich mit Wasser übergießen lassen. Dabei schauen sie verdammt sinnlich. Früher musste ich heimlich länger aufbleiben, um im Fernsehen junge Frauen mit so wenig Kleidung zu sehen.
Es ist 16 Uhr als der Fernseher explodiert. Vielleicht war Peter Lustig einfach sauer.
Folge 1: Tim in der großen Stadt
Am zweiten Abend verlaufe ich mich auf der Suche nach einem Biergarten. Einen Tag vorher hatte er sich mir noch als „größter Biergarten von Blablabla“ aufgedrängt. Ich will gerne dorthin zurück und finde den Weg einfach nicht. Der kleine Provinzler und die Großstadt, so schnell werden sie keine Freunde.
Drei Sterne, fremd finanziert. Ich residiere in kudammnähe und schreibe für die Festivalzeitung des Berliner Theatertreffens. Eingeladen wurden Nachwuchskulturjournalisten. Ich bin also ein winziges Stücklein Kulturförderung.
Für meine Verhältnisse ist das hier ein wahrlich edles Wohngefühl. Aber jeden morgen beim Frühstück nach meiner Zimmernummer gefragt zu werden, nervt schon. Wären es vier oder fünf Sterne, die Frühstücksbeauftragten könnten sich sicherlich schon nach dem ersten Tag die Gesichter ihrer Gäste merken.
Apropos Provinz. Wie provinziell ist es eigentlich, aus einem Automaten eine Flasche Wasser zu ziehen, die schon drei Tage abgelaufen ist? Und dass auch noch, wenn doch draußen gerade alle Menschen ihre Felle ablegen, aus den Höhlen kommen, ihre Körper zeigen und sich den Speck ablaufen. Die müssen doch schlucken wie zwei Spechte. Oder trinkt ihr alle kein Wasser? Mir schmeckt eigentlich auch das Bier momentan wieder sehr gut und ich kann immer besser meine kleinen Speckrollen am Bauch umfassen.
Der Sonntagmelancholie könnte ich in dieser Stadt vortrefflich ausweichen und durch Cafes wandern. Ausstellungen besuchen, einfach großstädtisch flanieren oder am 25-Kilometer-langen „Run Berlin“ mitlaufen. Aber ich mache gar nichts.
Gestern haben mich der erwähnte Bierkonsum und meine Frühblüher-Allergie hingerafft. Ich konnte mich gerade noch ins Olympia-Stadion retten und zuschauen, wie die Herthaner Hamburg zum Weinen und die Bayern zum Feiern brachten. Wenn ich mir überlege, was wohl an diesem Abend in München gesoffen wurde, fühle ich mich wie ein Asket.
Aber die Melancholie. Heute ist so ein Sonntag, an dem mir der Antrieb fehlt. Das ändert auch die Hauptstadt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die unregelmäßige Versorgung mit Nahrung in den letzten Tagen, zu einer ausgekochten Verstimmung meines Magen-Darm-Traktes geführt hat.
Ich streife also verloren durch die Straßen, als plötzlich ein junger Mann auf einem Fahrrad an mir vorbeiradelt. Er singt „Sunday Bloody Sunday“ mit leichtem Akzent. Türke, Franzose, Italiener? Ich will ihm hinterher rufen, wie Recht er doch habe. Aber er würde mich doch nicht hören. Wenn einem Bono ekstatisch seine Sorgen ins Ohr jammert, verschwindet alles andere. Selbst eine Stadt wie Berlin.
Folge 2: Tim in der großen Stadt
Begegnungen
U-Bahn fahren. Ich empfehle jedem, immer wieder mit der U-Bahn zu fahren. Nirgendwo entblättern sich die gesamten menschlichen Daseinsformen besser als unter der Erde. Die U-Bahn fährt zwar hier oft obererdig, aber Sie sollten die Untergrund-Strecken wählen. Im Dunkeln, wenn es draußen nichts zu gucken gibt, sind die Menschen stärker bei sich selbst. Sie sind sie selbst.
Wie Katrin. Es ist Mitternacht und sie fährt mit drei Freunden zurück nach Hause. Es war eine anstrengende „Dungeons & Dragons“-Session. Dass Katrin Katrin heißt, weiß ich, weil sie einen ordentlichen Ordner auf dem Schoß liegen hat. Sie trägt Sandalen und Socken, nickt mehr als dass sie redet und ist nicht traurig. Der Freund neben ihr nestelt an seiner AC/DC-Tasche, wippt mit den Beinen und sagt immer wieder: „Ich finde, wir sollten die Kiste öffnen und hineinschauen.“ Katrin nickt. Die zwei dicken Jungs gegenüber gehören zu der Gruppe, unterhalten sich ebenfalls noch über das Spiel, aber sind an einer ganz anderen Stelle. Den AC/DC-Taschen-Fan stört das ein bisschen und deswegen erzählt er jetzt Katrin, die ihm ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, warum die Qualität der Tasche nicht so toll ist. Irgendwann steigen er und die dicken Jungs aus. Katrin verändert kaum etwas an ihrem unsicheren Dauer-Minimal-Lächeln. Sie verliert auch anschließend nicht die Fassung, als zwei halbnackte Russinnen die U-Bahn betreten.
Marilyn Monroe ließ sich in ihr Kennedy-Geburtstagskleid einnähen. Die jungen Mädchen scheinen sich das zu Eigen gemacht zu haben. Oder vielleicht haben sie gebrochene Beine, die geschient werden müssen? Die Hosen reichen, die brauchen kein Metall. Aber wahrscheinlich sind sie biologisch gesund. In jedem Fall senden sie biologische Signale in ihre Umwelt. Der Bund der Hosen endet knapp über ihrer Scham. Sie trinken eine hellrote Flüssigkeit aus einer Colaflasche und sind mit Make-Up-Schichten bedeckt, die nach durchstandener Nacht mit einem kleinen Meißel abgeklopft oder von einem Jüngling mit Designrasur und Feinrippunterhemd abgekaut werden müssen. An einer Partyhaltestelle verlassen sie die Bahn und machen sich auf die Jagd. Wer da wen jagt, habe ich aber immer noch nicht verstanden.
Als mir schon die Augen zufallen, steigen eine Mutter und ihre zwei Kinder ein. Das Mädchen sitzt in einem Bollerwagen in Decken eingekuschelt und der Junge hat Augen wie ein nervöser Wüstenfuchs. Heute ist „Die klügste Nacht des Jahres“. Von 17 bis 1 Uhr nachts öffnen naturwissenschaftliche Einrichtungen Interessierten ihre Türen. Die Kleinfamilie war lange mit dabei. Das Mädchen ist so müde, dass ihr eine kleine Träne aus den Augen kullert. Leider kann ich ein fremdes Kind nicht einfach in den Arm nehmen. Der Junge mit dem Einstein-T-Shirt sucht weiter und fotografiert mit dem Telekom-Einweg-Fotoapparat ins finstere Berlin hinaus. Die Mutter lächelt und plötzlich ist alles ganz friedlich.
Folge 3: Tim in der großen Stadt
Ein ungeheimer Geheimtipp
Jeder weiß es. Fast jeder. Aber sie wollen trotzdem im stickigen Bus zugequatscht werden. Sie wollen Geschichstgedusel hören, Großstadtromantik, Politikerkitsch und Promitratsch. Alles durch ein schlechtes Mikrofon und dünne Boxen ins Ohr gequäkt. Weil die letzten 15 Euro für den Fahrpreis bezahlt wurden, fehlen jetzt Scheinchen, die oropaxig ins Ohr gedreht werden könnten. Also ertragen. Auch den vor einem sitzenden, dicken, schnaufenden Mann, der nach Schweiß müffelt.
In der Linie 100 der Berliner Verkehrsbetriebe kann man dagegen eine vollkommen stumme, wenn auch nicht geruchsneutrale Berlinrundfahrt genießen. Und das mit der ganz normalen Tageskarte, die man sich sowieso bereits am Morgen gekauft hat. Am Zoo geht’s los, über das Botschaftsviertel, Schloss Bellevue, Haus der Kulturen der Welt, Reichstag, Brandenburger Tor, Unter den Linden, Alexanderplatz, und so weiter. Sitzt man in den Doppeldeckerbussen oben und ganz vorne, stellt sich schnell das Gefühl ein, auf einem schwankenden Schiff durch die Stadtschluchten zu schippern. Immer haarscharf an Ampeln und Menschen vorbei. Jedes Mal wundere ich mich, wenn wieder niemand umgefahren wurde. Dieser ungeheime Geheimtipp führt jedenfalls dazu, in einem Bus zu sitzen, der immer sehr gut gefüllt ist.
An diesem Tag habe ich mal wieder Pech, denn Mathias und Laura sind mit ihrem Papa gekommen. Sie setzen sich nicht nur an meinen Lieblingslatz, also oben ganz vorne, sondern quatschen mehr, als es jeder Reiseführer tun würde. Papa: „Mathias, wer wohnt im Schloss Bellevue?“ Mathias: „Der Bundespräsident.“ Papa: „Richtig Mathias. Und wie heißt der?“ Mathias: „Merkel.“ Papa: „Fast. Merkel ist doch der Bundeskanzler.“ Mathias, etwas lauter: „Ne... dass ist doch die Bundeskanzlerin, Papa!“
Mathias ist etwa sechs Jahre alt und ein unglaublicher Klugscheißer und Fragenquengler. Aber wie soll auch etwas anderes aus ihm werden, wenn der Herr Papa ein Wissensfetischist ist. Aber schön dass Mathias seinen Vater vorführt, als dieser unsere Frau Merkel zum Manne macht. Er hat den Sexisten in seinem Papa entlarvt. Dass der Vater Sexist ist, zeigt er auch an anderer Stelle. Er spricht fast immer nur den Sohn an und antwortet relativ barsch, wenn die Tochter eine Frage stellt. Die Fahrt wird sehr anstrengend. Mathias fragt, Papa testet, Laura schweigt und ist ein bisschen traurig. Dass zu ertragen ist nicht leicht. Einem Mann neben dem Vater wird es irgendwann zu bunt und er will auch mal etwas sagen. „Wissen Sie eigentlich, was im Zweiten Weltkrieg im Hotel Adlon war?“, fragt der Mann und zeigt mit seiner schrumpeligen Hand zu dem Luxushotel. „Ein Lazarett“, antwortet er sich selbst. Der Vater nickt vollkommen desinteressiert. Die spannende Frage, ob der Mann dort gelegen hat, bleibt leider aus.
Ich bin froh, als ich an meinem Ziel endlich aussteigen kann. Vom Brandenburger Tor laufe ich zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas und versinke schnell zwischen den Stelen. Plötzlich ist es ganz still.
Du und ich auf dem Klo
Warum wir heute Abend gerade auf diesen drei Quadratmetern gelandet sind, wissen wir beide nicht. Aber jetzt stehen wir hier eben. Eigentlich stehe nur ich. Du sitzt auf dem heruntergeklappten Klodeckel und schaust auf meine Schuhe. „Warum habe ich die schon so lange nicht mehr geputzt“, denke ich und seufze dabei. Immer schweifen in solchen Momenten meine Gedanken ab und räkeln sich dort in vollkommener Bedeutungslosigkeit.
Draußen vor der Tür lachen sie so laut, dass ich jedes Mal zusammenzucke. Du hättest es mir vielleicht nicht gerade jetzt sagen müssen, meinte ich noch vor der Klotür zu dir. Deine Antwort kam trocken: „Dafür gibt es nie den richtigen Zeitpunkt.“
Uns ist es beiden etwas unangenehm, hier so nah beieinander zu sein. Aber das Klo ist gerade der sicherste Raum, in den wir so schnell kommen konnten.
Wir schweigen vielleicht drei Minuten, aber mir erscheint es ewig. Ich bitte dich kurz aufzustehen, weil ich dringend mal pinkeln muss. Was noch vor wenigen Minuten selbstverständlich gewesen wäre, macht mich nun unsicher wie einen Teenager. Das Gefühl der Vertrautheit sickert gerade dickflüssig aus einem zerbrochenen Gefäß.
Als ich so dasitze und pinkle löst sich ein ganz leiser Pups und wir lächeln uns breit an. Aber ich will nicht, dass du lächelst. Ich will nicht in diesem Lächeln alles sehen, was ich hatte, nur um gleichzeitig zu wissen, dass mit einem Schlag nichts mehr da ist.
Du merkst das auch und setzt gleich wieder dein Beerdigungsgesicht auf. Das sieht zwar blöder aus, ist aber doch der Situation angemessener. Ich bin fertig und Gentleman, also stehe ich auf und lasse dich wieder auf dem Klodeckel Platz nehmen.
Bis jetzt war meine Bitte, kurz die Toilette zu benutzen, dass einzige, was hier drinnen gesagt wurde. Es ist so Vieles und doch wieder nichts zu sagen. Ich ahne, deine Entscheidung ist diesmal endgültig. In meinem Kopf kommt dagegen der think tank jetzt erst richtig auf Touren. Wie Generäle auf irgendwelchen Karten Schlachtschiffe herumschieben, werden in dieser Beziehungsendeverhinderungszentrale die Möglichkeiten durchgespielt. Aber weil das hier ein Angriffskrieg ist und in meinem Fall die Strategie nicht so hoch angesehen ist, schieße ich gleich aus allen Rohren. Kurz darauf kullern Tränen, die so groß und schwer sind, dass sich selbst ein Mann dafür nicht schämen muss.
Aber du bist ganz Papst. An einer getroffenen und wohlbedachten Entscheidung, ist bei dir nicht zu rütteln. Und genau das zeigt mir sofort wieder, was ich an dir so liebe. Du bist eine der integersten Personen, die ich kenne.
Du sagst, dass Du jetzt pinkeln musst. Ich gebe dir einen Kuss auf die Stirn, verlasse das Klo und das Gebäude. Ich würde gerne alle meine Empfindungen fürs Erste dort lassen. Einschließen, hinunterspülen. Aber das geht nicht.
Deutschland ein Flaggschiff
„Auto-Fahnen – Zeigen Sie Flagge!“ AUSRUFEZEICHEN. So schreit eine Internetanzeige. Angeklickt geht es weiter zu Ebay. Dort dann 475 Angebote. Von 1,99 bis 9,99 plus 5 Euro Versand. Sofort Kaufen! Zuschlagen! Schnellversand! Ist ja bald wieder vorbei. Oder etwa nicht? Wie lange halten diese Flaggen eigentlich? Werden die überhaupt in Deutschland produziert? Und was macht man damit, wenn die Fußball-WM vorbei ist?
Bald stehen die Gesundheits-, die Föderalismus-, wenn nicht sogar die Deutschlandreform an. Auch da kann man Flagge zeigen und „Einigkeit und Recht und Freiheit“ in blühendem Glanze singen. Wer nach der WM wieder kneift, der ist doch kein echter Deutscher.
Patriotismus-Debatte, Party-Patriotismus. Was? Alles Quatsch. Tolle Spiele, einfach Wahnsinn. Deutschland einigt sich auf ein Vaterland. Ein schwarz-rot-goldenes. Tritt man vor die Tür, kommt schnell das Gefühl auf, wir wären ein Land, das nur noch aus hohen Staatsbeamten und Diplomaten bestehen würde. Staatskarossen hupen sich beflaggt durch die Straßen und die Leute schreien ihre Freude aus den Fahrzeugen heraus, als hätten sie gerade Frieden in den Nahen Osten gebracht. Natürlich dürfen sich auch die Engländer mit den Landesfarben schmücken. Aber nur wenn sie weiblich sind, und die Flagge auf ihre nackten Brüste gemalt ist.
Zurück zu den Fakten: Als die Fahnen ausverkauft waren, sind die Käufer schnell auf die Ware aus China umgestiegen. Die Chinesen sind zum Glück keine Gegner. Jedenfalls nicht im Turnier, nicht auf dem Platz. Und man kann sich nicht gleich um alles kümmern. Weltmeister werden und Weltwirtschaft kontrollieren kann man eben schwierig koordinieren. Dann lieber erstmal Weltmeister.
So, aber da der Titel schon sicher ist, müssen wir uns langsam auch um den Rest kümmern. Zum Beispiel, ob Gefahr besteht, dass neben den Fahnen auch das Bier ausgehen könnte und wir Plörre aus dem Ausland ordern müssen, die nicht nach dem Deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Hier ist Verbraucherminister Horst Seehofer gefragt. Herr Minister, bitte stellen Sie die Bierversorgung sicher und sorgen Sie für ordentlich Kühlung.
Auch Kanzlerin Angela Merkel sollte in jedem Fall nach dem Finale mit Wolfgang Grupp, dem Inhaber von Trigema (“Deutschlands größter T-Shirt und Tennis-Bekleidungs-Hersteller”) sprechen, damit er in seinen hochgeschlossenen Hemden auch weiterhin mit 1200 Mitarbeitern nur in Deutschland produziert. Und er sollte schon einmal Stoffe in diesen Farben auf Vorrat anschaffen: Grün, Rot, Gelb, Schwarz, Blau und Weiß. Denn daraus setzt sich die Südafrikanische Flagge zusammen. In vier Jahren ist schon wieder WM. Wenn Deutschland 2010 in der Vorrunde ausscheiden sollte, muss Herr Grupp darauf vorbereitet sein, Flaggen nach Südafrika zu liefern. Denn dann sind wir doch noch Fußballweltmeister. Und Weltmeister lassen sich nicht gerne abhängen. Auch nicht in der Wirtschaft.
Zuggeschichten: Ein Deutscher in Amerika
Als ich wieder zu Hause bin, schlage ich als erstes den Atlas auf. Ich suche Cleveland, den Eriesee. Mein Atlas ist alt. Cleveland ist popelig und der See ein langweiliger, ausgeblichener Fleck. Also lieber Cyberspace. Ich schalte den Computer ein, öffne Google Earth und zoome mich nach Cleveland. Das riesige Football-Stadion springt mir als erstes entgegen. Es scheint am Hafen zu liegen. Daneben Lakewood, Haus an Haus, amerikanische Suburb-Architektur. Die Häuser stehen so dicht, dass man sich gegenseitig beim Leben zuschauen kann.
Die Größe der Stadt relativiert sich jedoch, wenn man Cleveland neben diesem riesigen See liegen sieht. Sattes dunkles Blau, unendliche Fläche. Big-Size-America. Der Grund, warum ich mir anschließend noch die Häuser des seenahen Standrandes anschaue, ist die Begegnung mit einem Ehepaar auf der Zugfahrt von Essen nach Hannover.
Oft überlege ich, ob ich andere Menschen im Zug ansprechen darf oder sie lieber in Ruhe lasse. Als ich höre, dass dieses Paar Englisch miteinander spricht, durchbreche ich den Höflichkeitsabstand und frage, woher sie kommen. Der Mann antwortet auf Deutsch: „Aus Cleveland, Ohio. Direkt am Eriesee.“ Die Blicke sind noch etwas skeptisch. War es doch eine Grenzverletzung? Es steckte jedoch ein Stolz in dieser Aussage, der ergründet werden will.
Im letzten Jahr war ich für vier Wochen in Dallas, Texas. Eine schwierige Zeit. Aber ich habe die Erfahrungen sehr genossen, Amerikaner kennen zu lernen. Der Fast-Food-Bush-Krieg-Wahnsinn vermittelt vielen wohl das Bild, alle Amerikaner wären fett und zurückgeblieben. Ich habe dagegen eine herzliche Offenheit erfahren, die sich nicht in Oberflächlichkeiten erschöpfte. Und einen schwulen Republikaner zu treffen, hat mir auch wieder etwas mehr Vertrauen in die Welt gegeben. Wenn es den gibt, dann ist auch sonst viel möglich.
Nachdem ich erfahren habe, dass das Ehepaar aus Amerika ist, steigert das meine Neugier. Aber die beiden erzählen auch gerne. Der Mann ist vor 50 Jahren nach Kanada ausgewandert und hat dort in der Papierproduktion gearbeitet. Ich schätze ihn auf 75. Damals wie heute suchen die Kanadier immer gut ausgebildete Leute. Er hatte Glück und wurde bald darauf mit neu erworbenen Maschinen nach Amerika versetzt. Nicht dass er Kanada nicht mochte. Ganz im Gegenteil. Aber die Karriere war ihm schon wichtig. In Amerika leitete er dann eine Firma mit 80 Angestellten. Sie produzierten Papier, das in irgendeiner Form mit Plastik und Metall verbunden wird. Mit ihren Produkten belieferten sie sogar Dependancen des Autoherstellers Ford in Deutschland. Leider habe ich nicht genau verstanden, was genau sie produziert haben, aber er scheint erfolgreich gewesen zu sein. An drei Fingern trug er dicke Goldringe.
Seit er in Rente ist, fährt er mit seiner Frau jedes Jahr für etwa drei Monate nach Europa. Sie schlagen ihr Lager in Berlin auf und von dort entdecken sie den alten Kontinent. Zurückkehren nach Deutschland würde er trotzdem nicht. Amerika ist seine Heimat.
Wir sprechen noch über das Gesundheitssystem in Amerika und die Umwälzungen die gerade auch in Deutschland passieren. Er hat gerade eine Versicherung nur für seine Pillen abgeschlossen. Jetzt bezahlt er nur noch 1500 Dollar, statt vorher 2500 für seine Komplettversorgung. Für ihn ist die Reform eine Erleichterung, aber für viele würde die Gesundheitsversorgung immer schwerer, erklärt er. Zwei Stunden unterhalten wir uns ohne Pause. Englisch, Deutsch oder auch mal nur mit einem Blick. Kurz vor Hannover überlege ich, ob ich sie nach ihren Namen oder einer Adresse fragen soll.
Plötzlich sind wir da. Hannover Hauptbahnhof. Die Verabschiedung wird sehr herzlich. In einer Woche werden die beiden schon wieder in ihrem Haus am Eriesee sitzen. Ich stelle mir vor, wie ich sie irgendwann dort besuchen werde. Ich würde an der Küste entlangfahren und nach dem Deutschen fragen. Aber wahrscheinlich würde ich sie gar nicht finden, denn nach ihren Namen habe ich sie nicht gefragt.

|
Schon lange fort
Als ich ihn vor etwa eineinhalb Wochen besuchte, öffnete er die Augen ein kleines Stück mehr als bei unserer letzten Begegnung. Die Lungenentzündung war abgeklungen und der Schleim musste nicht mehr aus seinem Rachen abgesaugt werden. Er zuckte wieder ein bisschen, wenn man ihn berührte. Das war eigentlich ein gutes Zeichen. Drei Wochen lang lag er zuvor regungslos im Krankenhaus, röchelte und stöhnte.
Jetzt war er wieder in seinem Zimmer im Pflegeheim. Ich streichelte ihm über die Wange und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Bevor ich ging, flüsterte ich in sein Ohr: „Gute Reise, Heini.“ Eine Woche später ist er gestorben, heute ist seine Beerdigung. Als ich von seinem Tod erfuhr, war ich nicht traurig. Ich hatte schon vor vielen Jahren von ihm Abschied genommen.
In meiner Erinnerung hat mein Opa fast schon immer Alzheimer. Die ersten Symptome müssen vor über 15 Jahren aufgetreten sein. Als er in Rente ging, verstärkten sie sich und als vor sechs Jahren seine Frau starb, vergaß er innerhalb kürzester Zeit unsere Namen und verschwand.
Zu Ostern schenkte mir Opa Heini ein Rennrad. Mein Bruder bekam auch eines. Wenn die Bremsen kaputt waren, reparierte er sie. Ich kann das bis heute nicht. Sein Keller war voller Werkzeug. Die riesigen Bohrer nahm ich öfter in die Hand, aber für Handwerk in jeder Hinsicht konnte er mich trotzdem nicht begeistern. Mein Vater sagt dagegen heute: „Alles, was ich handwerklich kann, habe ich von Heini gelernt.“ Ich fuhr mit ihm lieber zu den Kühen. Ich weiß nicht, warum mich das so faszinierte und ob ich vielleicht Angst bekam, wenn sie ihren langen Zungen herausstreckten. Opa Heini hatte riesige Hände.
Wenn ich ihn im Pflegeheim besuchte und die Decke etwas zur Seite rutschte, schaute ich auf seine dünnen Beine und dachte darüber nach, was aus diesem Mann geworden war. Wie viel Mensch er noch war, ob er Gedanken hatte, die Umwelt wahrnahm oder spürte, wenn man ihn berührte? Seine Hände waren noch immer riesig, aber leblos. Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste und davon überzeugt war, traf ich eine Entscheidung. Ich ging davon aus, dass mein Opa schon fort war und nur noch sein Körper im Bett lag. Ich verabschiedete mich emotional von ihm.
Opa Heini war ein harter Bursche. Er sagte etwa: „Wenn ich irgendwann blöde werde, gehe ich in den Keller und schieße mir mit der Schrottflinte den Kopp weg.“ Über diese Sprüche lachte man in unserer Familie. Trotzdem ahnten wir, dass er es Ernst meinte. Als er blöde wurde, wusste er nicht mehr, wo seine Schrottflinte liegt oder wie man die überhaupt benutzt. Vor eineinhalb Wochen setzten meine Eltern seinen Wunsch um und stellten die künstliche Ernährung ein. Für mich bekam er damit seine Würde zurück.
Als ich das letzte Mal aus seinem Zimmer ging, wusste ich, dass mein Opa bald stirbt. Das war in Ordnung, eigentlich sogar ein gutes Gefühl. Ich dachte, selbst wenn hinter diesem unbeweglichen Schleier seines Gesichtes noch ein Bewusstsein sein sollte, er würde sofort darum bitten, ihm den Schlauch aus der Nase zu ziehen. Er wäre viel zu Stolz gewesen, diese Entscheidung jemand anders treffen zu lassen. Jetzt haben wir sie für ihn getroffen. Gute Reise, Heini.
Dallas, Folge 1

Ein Monat Amerika, genauer
Dallas in Texas. Ein Kreuz auf der Straße markiert den Todesschuss auf
John F. Kennedy, und George W. Bush machte hier seine ersten Schritte als Politiker.
In Deutschland war mein Kopf in letzter Zeit wie einbetoniert. Was könnte
da besser sein, als viele tausend Kilometer Distanz zu schaffen.
Das Erste, was von mir in Amerika ankommt, sind meine biometrischen Daten. Linker
Fingerabdruck, rechter Fingerabdruck und ein Foto. Ein Schild weist daraufhin,
man könne sich erkundigen, was mit den Daten passiert. Nein danke, macht
ihr mal. Und immer wieder die Frage, was ich denn in Amerika wollen würde.
„Den amerikanischen Präsidenten töten und die nationale Ordnung
zerstören!“, möchte ich sagen, reiße mich aber im letzten
Moment zusammen. „Ich besuche einen Freund.“
Schon auf dem Londoner Flughafen
kontrollieren eingeflogene Amerikaner. Ich muss die Schuhe ausziehen –
sie werden auf Waffen überprüft - und mit einem kleinen Staubtuch
wischen sie in meinem Rucksack herum und scannen anschließend die Probe.
Okay, der 11. September war ein mehr als schlimmes Ereignis, aber müsst
ihr denn gleich so hysterisch sein? Nachdem ich an der letzten Kontrolle versichere,
keine Wurst bei mir zu haben, darf ich den Flughafen in Fort Worth/Dallas verlassen
und endlich Amerika betreten.
Jeden Tag Regen. Heute ist
es ein staubfeiner Nieselregen, wie ihn sonst nur Hightechduschen in Spaßbädern
zaubern können. Naja, ist vielleicht besser als die 45° Celsius im
Juli und August. Ich wohne in der Clinton Ave. Bei Leslie Johnson. Der 63-jährige,
pensionierte Lehrer hat mich aufgenommen, ohne mich zu kennen. Ein Freund hat
den Kontakt hergestellt. Als Gegenleistung helfe ich Leslie beim Renovieren
seines Hauses. Das ist hier ein weit verbreitetes Hobby, um nebenbei Geld zu
verdienen. Leslie arbeitet jetzt an seinem vierten Haus. Mit dem ersten hat
er 2000 Dollar Gewinn gemacht, mit dem letzten 60 000. Das läuft deswegen
so gut, weil die Menschen hier alle in die Suburbs, die Vororte, ziehen. Dallas
ist eine Millionenstadt und das Zentrum wirkt fast wie ausgestorben. Man versucht
jetzt dagegenzusteuern und baut Wohnkomplexe ins Zentrum.
Leslies Haus ist ein kaum geordnetes
Chaos. Nur das Schlafzimmer mit dem Fernseher - mit einer geschätzten Bildschirmdiagonale
von mindestens 150 Zentimetern - scheinen fertig zu sein, beziehungsweise einen
Platz zu haben. Als ich Leslie frage, wann wir denn etwas an dem Haus machen
wollen, zündet er sich eine Zigarette an, fläzt sich aufs Sofa und
sagt: „Wenn wir etwas machen wollen, machen wir etwas. Wenn wir nichts
machen wollen, dann machen wir nichts.“
In der nächsten Folge:
Wie es ist, in einem Hummer zu fahren, warum Leslie männliche Huren und
andere aus der 20 000-köpfigen-Schwulencommunity in Dallas kennt und warum
einen wildfremde Menschen auf der Straße anlächeln und nach dem Befinden
fragen.
Dallas, Episode 2

Also, in einem Hummer zu fahren
ist irgendwie überflüssig. Fährt man mit diesem auf zivil getrimmten
Militärjeep einfach nur auf der Straße, ist es etwa so, als würde
man mit einem Panzer den Rasen mähen. Aber size matters hier eben. Wer
es sich leisten kann, fährt den größten Jeep oder Truck, den
er bekommen kann. Und in Texas wollen sie es eh immer alles noch ein Stückchen
größer. Deswegen gibt es hier auch den Begriff „Texas Size“.
Zu Hause bin ich mit einer Pizza meistens nur leidlich gesättigt, hier
muss ich etwa ein Viertel in den Kühlschrank stellen. Mein Magen muss sich
erst noch ein bisschen weiten.
Trotzdem habe ich noch keine menschlichen Walrosse gesehen, wie man sie aus
dem Fernsehen kennt, aber das liegt einfach an den Leuten in der Nachbarschaft.
Hier in Winnetka Heights leben vor allem mittelständische und höher
gestellte Leute. Bank-, Regierungs-, oder-was-auch-immer-für-Geschäfte.
Die Mütter sind vornehmlich zu Hause und erziehen die zukünftigen
Leader of America. Es ist eine Entscheidung der Kinder wegen.
Die Nachbarschaftscommunity
lerne ich bei einem Barbecue kennen. Auf dem Grill liegen zwei Kilogramm schwere
Fleischbatzen und weil man nicht weit entfernt von Mexiko lebt, gibt es Tortillas
mit verdammt gut gewürzter Füllung. Natürlich isst hier keiner
ein Steak in dieser Größe, alle haben nicht Bush gewählt und
man liebt Independentfilme wie „Lost In Translation“. Trotz all
der herzlichen Menschen hier, habe ich Heimweh. Leslie will mindestens zweimal
täglich von mir umarmt werden und seit meinem zweiten Tag hier, gibt er
mir zusätzlich immer noch einen Kuss auf die Wange. Ich würde ihm
gerne sagen, dass er das lassen soll, aber so etwas fällt mir nicht leicht.
Gerade weil er so warmherzig ist. Als ich aber gemerkt habe, der Point of no
return rückt immer näher, trat ich auf die Bremse. So gern ich nach
Houston und Austin fahren würde, wir beide auf einer Tour, das würde
nicht gut gehen. In manchen Momenten bin ich schon so sehr von ihm genervt,
dass mich der Sound seiner rauchigen Stimme fast anekelt. Wenigstens haben wir
geklärt, dass er mir nicht an die Wäsche will.
Ich bewege mich zwischen zwei
Welten, wie sie fast nicht unterschiedlicher sein könnten. Leslie mit seinem
katastrophalen Haus und den Freunden, von denen jeder für sich eine Geschichte
Wert wäre. Und auf der anderen Seite Andres Calderon, der mir den Kontakt
zu Leslie vermittelte und der mit Ehefrau Kristin, Kind Isaiah, Hund, Katze,
Haus und Garten ein kleines, wie vom Bundesministerium für Familienplanung
erdachtes Leben führt. Immer wenn ich Andres auf unseren abendlichen Spaziergängen
von Leslie erzähle, sagt er mit einem Lächeln: „Mein Leben ist
so langweilig.“
Beim nächsten Mal mehr
über den drogenabhängigen Cyrus, der seiner Mutter zum Muttertag Valium
geschenkt hat und warum es gar nicht so einfach ist, in der Nähe von Dallas,
den Kindheitstraum zu erfüllen, mit einem Pferd durch die texanische Steppe
zu reiten.
Dallas, Gaytopia (Folge 3)

Wie, Neuwahlen? Auf einmal
merke ich, wie weit ich von zu Hause weg bin. In den ersten Wochen habe ich
mich nicht über das Geschehen in Deutschland informiert, aber am Sonntag
wollte ich dann doch Wissen, wie die Wahl in Nordrhein-Westfalen ausgegangen
ist. Und jetzt wirklich Neuwahlen? Ich denke, Gerhard Schröders Körpertemperatur
war an diesem Tag ähnlich fiebrig wie die Luft in Dallas in den letzten
Tagen. Wir haben mittlerweile konstant 38 Grad und das wird sich jetzt bis September
nicht mehr ändern. In den Einheimischen wächst deswegen eine leichte
Angst und für einen in Deutschlands Klima sozialisierten Menschen ist das
nahezu unerträglich. Aber mein Abenteuer wird bald enden, die Texaner können
sich nur in ihre klimatisierten Häuser zurückziehen und das Leben
verdösen.
Hinter mir liegt eine Woche mit meiner wunderbaren Gastfamilie Calderon. Ich
lebe zwar noch in Leslies Haus, flüchte aber so oft wie ich kann. Und weil
Andres drei Tage beruflich in Washington weilte, half ich Kristin ein bisschen
mit dem kleinen Isaiah.
Nach zwei Wochen weiß
ich nun, dass meine Reise eine andere Bestimmung hat, als ich vorher gedacht
habe. Ich komme nicht so viel herum und sitze auch nicht unter Bäumen,
um über mein Leben nachzudenken. Ich treffe Menschen, finde Freunde. Phillip
sagte gestern zu mir, ich sei so etwas wie ein fremdartiges Spielzeug für
sie. Andere Sprache, anderes Leben und irgendwie interessant. Ich hoffe nur,
das Spielzeug ist nicht bei meinem nächsten Besuch schon langweilig. Kaputtgespielt.
Manchmal frage ich mich, woran
es liegt, dass ich hier so viele Menschen kennen lerne. In Deutschland konnte
ich das schon seit langen nicht mehr. Ist es nur, weil ich für die Amerikaner
eine Art Alien bin, in dessen Fremdartigkeit sie sich sonnen wollen? Bin ich
mutiger hier? Oder sind sie hier einfach sozialere Menschen? Wahrscheinlich
von allem ein bisschen und ich genieße es.
Die größte Entäuschung
kam in der letzten Woche von dem guten Syrus. Er hatte mich eingeladen mit ihm
nach Los Angeles zu fliegen und nach langem Zögern nahm ich an. Am Tag
der Abreise, ich war um 6.30 Uhr aufgestanden und aufgrund deutscher Pünktlichkeit
um Punkt 8 Uhr, zur verabredeten Zeit, fertig. Um 8.30 Uhr rief er mich an und
sagte, er hätte wohl etwas Falsches gegessen und müsste nun die Reise
absagen. Okay, wenn er krank ist, geht das nicht, aber irgendwie glaube ich
ihm nicht ganz. Rob vermutet, er hätte die Sache im letzten Moment abgeblasen,
weil ihm klar wurde, dass mit mir auf der Reise kein Körperkontakt stattfinden
würde. Na ja, ich weiß nicht ... Aber Rob ist auch schwul, vielleicht
weiß er mehr als ich. Weil 80 Prozent der Menschen, die ich hier kennen
lerne, schwul sind, nenne ich das Gebiet hier nun Gaytopia. Ich bin mir meiner
Heterosexualität sehr bewusst und fühle mich wohl hier. Rob ist übrigens
schwul und Republikaner. Wir haben darüber im Pool plantschend diskutiert.
Aber das ist eine andere Geschichte.
In der nächsten Folge
über eine Ranch in Oklahoma und vielleicht endlich über meinen Kindheitstraum,
in der Steppe zu reiten.
Dallas, Oklahoma (Folge 4)


Memorial Day. Andres, Kristin,
Isaiah und ich fahren nach Oklahoma. Sechs Stunden Autotrip und wir hoffen,
unser eineinhalb-jähriger Spatz schläft so lange wie möglich.
Es werden zwar nur eineinhalb Stunden, aber er bleibt für sein Alter auch
anschließend verhältnismäßig brav.
Endlich sehe ich das, was ich mir erhofft habe. Unendliche Weiten, Westernlandschaften,
Indianerland. Um so mehr wir uns aus Dallas entfernen, dünnt sich die Besiedelung
aus und der Blick öffnet sich zum Horizont. Wenige Weizenfelder und sonst
nur glücklich grasende Rinder. Das Fleisch ist sicher hervorragend. Nicht
zum ersten Mal auf meiner Reise in Amerika ärgere ich mich, Vegetarier
zu sein.
Wir besuchen die Ranch von
Kristins Oma und es wird eine Familienfeier, wie ich sie mir schöner nicht
vorstellen kann. Ich muss an einen richtig guten Kindergeburtstag denken, bei
dem auf eine Attraktion die nächste folgt. Hervorragendes Essen aus New
Mexico, Bier trinken, reden, Spaziergänge, Fischen gehen, auf der Ladefläche
eines Pick-ups fahren und in den Sternenhimmel schauen, ein verfallenes Haus
erkunden… Alle sind fröhlich und es gibt nicht den Hauch einer Unstimmigkeit.
So eine Familienfeier habe ich in Deutschland schon lange nicht mehr erlebt.
Man redet nicht über die Kranken und Toten in der Nachbarschaft oder streitet
über Nichtigkeiten. Hier ist man ausgelassen und im besten Sinne familiär.
Und mein Glück mit den
Menschen setzt sich fort. Ich bin der Einzige, der nicht zur Familie gehört,
werde aber sofort und absolut integriert. Es ist schwer, diese Menschen nicht
umgehend ins Herz zu schließen.
Am großen Teich, wie
ihn die Kinder nennen, fange ich fünf Fische. Alle zu klein, um sie zu
braten. Trotz Vegetarismus hätte ich meinen selbst gefangenen Fisch gegessen.
So hinterlasse ich nur Piercings. Ja und die Fahrt zurück zur Ranch ist
mit das Tollste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Ein Bier in der Hand
liege ich auf der offenen Ladefläche des Pick-ups und schaue in den Sternenhimmel.
Der Fahrtwind treibt mir Tränen aus den Augen.
Nur ein Pferd bekomme ich in
Oklahoma nicht. Aber ich habe es getan. Schon letzte Woche habe ich die Marshall
Creek Ranch besucht und bin auf Oklahoma (welch ein Zufall) geritten. Mein Cowboy-Kindheitstraum
ist also auch erledigt.
So neigt sich meine Reise dem
Ende entgegen und ich bin bis oben hin angefüllt. Heute lande ich in Hannover
und dann haben mich wieder ganz andere Dinge fest im Griff. Aber wahrscheinlich
bin ich einer der wenigen Deutschen (wenn es überhaupt andere gegeben hat),
die bei einem Profibaseballspiel die amerikanische Nationalhymne „Star
Spangled Banner“ gesungen haben. Mit einem Chor, in einem riesigen Stadion.
Aber das ist mal wieder eine andere Geschichte.
Urlaubsvorbereitungen
Durch den morgendlichen Schleimschleier, dieser Schlafrest auf den Augen, sieht der graue Himmel ganz grau aus. So schwer. Als würde er voller Elefanten hängen. Wenn die plötzlich runterfallen würden? Aber vielleicht wäre dann endlich Sommer. Ein elefantöser Sommer, mit Pauken und Trompeten. Doch der Sommer ist verdammt noch mal nicht da. Also raus aus Deutschland. Unser Zeitfenster beträgt acht Tage. Ein gewagtes Spiel. Last Minute eben.
„Da ist nichts mehr dabei, was ich euch guten Gewissens anbieten könnte.“ Bei LTU kann der junge Mann – dynamisch, dunkelhaarig und Träger einer Tolle – nichts mehr für uns tun. Trotzdem sucht er weiter. Die dynamischen Männer haben noch Biss, die bemühen sich bis die Finger die Tastatur vollbluten. „Vor zwei, drei Wochen hätte ich euch die Top-Angebote machen können.“ Ja toll, wir haben wohl diesen Last-Minute-Scheiß irgendwie falsch verstanden. Nach einigen anderen Schaltern und Sackgassen scheint Ole von AS-Superreisen endlich doch noch das Passende für uns zu finden. „Darf es auch die Türkei sein?“ Ja, klar!
Drei Stunden Autofahrt nach Leipzig. Von dort geht der Flug um 2.40 Uhr. Das Auto rollt ruhig, ich bin nicht müde. Auf dem Flughafen erste Anzeichen worauf wir uns hier eingelassen haben. Sächselnde Drängler mit komischer Kleidung und noch komischeren Frisuren schnappen uns die Fensterplätze weg. Zahnlose Mütter trösten ihre müden Kinder. Und Jungs in Dreiergruppen gelen auf dem Klo ihre Haare nach. Der Plan: Im Flugzeug sollen die ersten alleinreisenden Touristinnen klargemacht werden.
„Ich kann Ihnen noch zwei zusammenhängende Plätze geben.“ Wir schauen uns fragend an. Ach wirklich, es wäre für uns auch kein Problem in unterschiedlichen Flugzeugen zu fliegen. Aber trotzdem vielen Dank. Ist es nicht selbstverständlich zusammenhängende Plätze zu bekommen? Im Flugzeug reicht mir Bea ihre Hand über den Gang und drückt meine ganz fest. Sie hat Angst beim Start. Wenn ich mir die ranzigen Sicherheitsinformationsblätter anschaue, bleibt mein Magen auch nicht ganz unbewegt. Andere im Flugzeug können sich nicht einmal festhalten. Sie rufen sich über mehrere Reihen hinweg mutmachende Sprüche zu. Start!
„Bleibe sie lange so angeschnallt, bis erloschen Zeichen. Gute Urlaub und vielen Dank, dass sie mit Interflug geflogen sind. Dank auch im Namen unseres Kapitäns ...üzür Ölör...“ Ein unverständliches Umlautgewitter, nach dem sich die Wogen erst wieder glätten müssen. Dann Applaus und raus und weg. Schnauze voll jetzt! Und wenn mir jetzt noch jemand zollfreie Zigaretten anbietet, ramme ich ihm die ganze Stange quer in den Mund!
Geschafft. Die Luft riecht, als ob ihr jede Erinnerung an so etwas wie Regen aus dem Kopf gebrannt wurde. Es ist heiß und 7 Uhr morgens. In einer Kolonne von Koffer ziehenden Touristen steuern wir den Interflug Schalter an. In akzentfreiem Deutsch bekommen wir einen Bus zugeteilt. Mehmet wird uns ins Hotel chauffieren. Grauer Schnauzer, dunkle Sonnenbrille und Baskettballergröße. Mehmet ist der erste Türke in der Türkei, zu dem ich aufschaue. Dann bringt er uns sicher ans Ziel: „Yeni Hotel International“, Alanya, Türkei.

|